Ausgabe 17/2018 - 27.04.2018
sozial-
Pflege
Gewalt
In der Tabuzone: Misshandlung von Pflegebedürftigen

epd-bild/Werner Krüper
Köln (epd). Jeden Morgen hatte Helga Niemann das gleiche Problem mit ihrer demenzkranken Mutter: Die 92-Jährige sträubte sich, wenn sie gewaschen und angezogen werden sollte. "Sie machte sich steif wie ein Brett." Irgendwann riss der Tochter, die eigentlich anders heißt und namentlich nicht genannt werden möchte, der Geduldsfaden. "Ich schrie sie an und haute ihr das Handtuch um die Ohren."
30 bis 40 Prozent der Angehörigen üben schon einmal verbale oder physische Gewalt gegenüber einem pflegebedürftigen Verwandten aus. Zu diesem Ergebnis kommen verschiedene Studien, die das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) zusammengetragen hat.
Studie belegte Ausmaß von Gewalt
Ähnlich sieht es in Seniorenheimen oder Krankenhäusern aus. Das fand das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln in einer im Herbst 2017 veröffentlichten Umfrage unter rund 400 Pflegekräften und Pflegefachschülern heraus. "Fast jeder dritte Befragte sagt, dass Maßnahmen gegen den Willen von Patienten, Bewohnern und Pflegebedürftigen alltäglich sind", berichtet Institutsdirektor Frank Weidner. Zehn Prozent der Befragten hatten in jüngster Zeit konkrete Gewalterfahrungen.
Das Problem: "Fast alle Angehörigen oder Pflegekräfte fangen liebevoll und idealistisch mit der Pflege an. Aber sie stoßen dann oft an ihre Grenzen", beobachtet Gabriele Tammen-Parr, Leiterin von "Pflege in Not", der diakonischen Beratungs- und Beschwerdestelle bei Konflikt und Gewalt in der Pflege älterer Menschen in Berlin. Die Folge seien nicht nur Handgreiflichkeiten, sondern auch psychische Gewalt.
Denn auch unterlassene Hilfe oder das Hinweggehen über Wünsche seien Misshandlungen, die häufig vorkämen, sagt Tammen-Parr. Etwa wenn ein Patient darum bitte, auf die Toilette gebracht zu werden, und dann zur Antwort bekomme, er möge in die Windel machen. Das sei extrem erniedrigend.
Bei Mangel an Fachkräften nimmt Gewalt zu
"Das Thema Gewalt in der Pflege ist in jüngster Zeit noch akuter geworden, als es ohnehin schon war", stellt Tammen-Parr fest. Grund sei der zunehmende Mangel an Pflegekräften. Um mehr Pflegekräfte gewinnen und einstellen zu können, fordert Pflegeexperte Weidner von der künftigen Bundesregierung einen Masterplan für die Pflege. Dafür würden mindestens zwölf Milliarden Euro pro Jahr benötigt. "Ein Ruck durch das System ist nötig", sagt der Experte.
Außerdem müsse das Thema Gewalt und Aggression in der Aus- und Weiterbildung einen höheren Stellenwert bekommen. Denn auch Pflegende werden häufig angegriffen. In einer repräsentativen Umfrage des ZQP gaben 40 Prozent von ihnen an, schon einmal Opfer von Aggressionen von Pflegebedürftigen geworden zu sein.
Doch obwohl Gewalt und Aggressionen im Heim- und Krankenhausalltag offenbar Normalität sind, beschäftigen sich wohl die wenigsten Einrichtungen mit dem Problem. Das Thema sei immer noch ein Tabu, beobachtet Tammen-Parr. Das bestätigt auch die Umfrage des Instituts für angewandte Pflegeforschung. Darin gaben rund 80 Prozent der Pflegekräfte an, dass Gewalterfahrungen sowohl von Patienten als auch von Pflegenden selten oder nie thematisiert und aufgearbeitet werden.
Kultur des Hinschauens wird gebraucht
"Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass es in Altenheimen, Krankenhäusern und in der ambulanten Versorgung endlich eine neue Kultur des Hinschauens und der Achtsamkeit geben muss", fordert Weidner. Über Gewalt in Pflegebeziehungen werde viel zu häufig noch geschwiegen, stellt auch ZQP-Vorstandsvorsitzender Ralf Suhr fest. "Momentan bewegen wir uns hier gesellschaftlich noch viel zu sehr in den Wahrnehmungsextremen Gleichgültigkeit und Scham oder einer Skandalisierung und Stigmatisierung."
Helga Niemann schaute sich nach Hilfe um, nachdem ihr bei ihrer Mutter die Nerven durchgegangen waren. Sie wandte sich an eine der Beratungs- und Beschwerdestellen für alte Menschen, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Krisentelefone organisiert sind. Dort fand sie eine verständnisvolle Beratung. "Das war eine Erleichterung für mich", sagt sie. Jetzt kommt morgens ein Pflegedienst, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter sei deutlich konfliktärmer geworden.
Pflege
Gewalt
Interview
Konfliktforscher: Ökonomisierung der Pflege begünstigt Gewalt

epd-West/Universität Bielefeld
Bielefeld (epd). "Die Pflege wird weniger als ein soziales Verhältnis zwischen Pflegenden und Patienten verstanden, sondern eher als ein ökonomisches Dienstverhältnis", sagte Zick dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Fragen stellte Claudia Rometsch.
Pflege und die Versorgung kranker Menschen seien zwar schon lange ein Arbeitsbereich, in dem es zu Gewalt komme. "Dass wir nun mehr darüber hören, liegt daran, dass sie ein so hohes Ausmaß angenommen hat, dass sie nicht mehr übersehbar ist."
Der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld (IKG) kritisierte vor allem den zunehmenden Zeitdruck auf das Pflegepersonal. "Die enge Zeittaktung und die mangelnden Möglichkeiten, sich auf Stresssituationen einzustellen, sind die Faktoren, die Konflikte öfter in Aggression und Gewalt münden lassen."
Denn unter Zeitdruck entstünden leichter Missverständnisse. "Das erhöht die Gefahr von Aggressionen, wenn die beteiligten Personen in einer negativen Stimmung sind und sich nicht anders als mit Aggression und Gewalt zu helfen wissen." Zick kritisierte auch, dass zu wenig Zeit in die Ausbildung des Personals investiert werde. Zum Beispiel fehlten häufig Trainings zur Stärkung der Kommunikationskompetenzen sowie der Konflikt- und Gewaltprävention. Außerdem müsse in den Einrichtungen gewährleistet werden, dass Gewaltsituationen nachbereitet und aufgearbeitet würden.
Gewalt lasse sich nur durch achtsame Pflege verhindern, sagte Zick. "Das funktioniert nicht, wenn man weiter spart und Pflegekräfte im Schnellverfahren auf einen rabiaten Pflegemarkt wirft."
Pflege
Gewalt
Keine Hilfe, kein Rat

epd-bild/Werner Krüper
Mainz (epd). Der Wormser Fachkrankenpfleger Udo Haas hat regelmäßig mit Menschen zu tun, die äußerst aggressiv werden. Manche seiner Patienten wehren sich massiv dagegen, dass sie bei der Neuaufnahme Messer und Rasierklingen abgeben müssen. Andere sind so gefährlich, dass sie zwangsweise Medikamente erhalten oder fixiert werden müssen. "In der Akutpsychiatrie ist Gewalt alltäglich", sagt er.
Die rheinland-pfälzische Landespflegekammer hat jetzt Alarm geschlagen, da die Zahl der Übergriffe auf das Pflegepersonal immer weiter zunimmt. Zur Realität in Krankenhäusern und Pflegeheimen gehört aber auch, dass manche Pflegekräfte selbst gewalttätig werden.
"Thema aus der Tabuzone holen"
"Das Thema Gewalt muss aus der Tabuzone herausgeholt werden", sagt Hans-Josef Börsch vom Vorstand der rheinland-pfälzischen Landespflegekammer. Beim Jahreskongress der Berufsvertretung in Mainz steht die Frage im Mittelpunkt, wie Pflegekräfte vor Angriffen besser geschützt und übergriffige Kollegen rechtzeitig gestoppt werden können.
Daniel Tucman, Pflegewissenschaftler am Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) in Köln, hat nicht nur darüber geforscht, wie stark Klinik- und Seniorenheimmitarbeiter von Gewalt betroffen sind, sondern selbst einschlägige Erfahrungen machen müssen. Im Zivildienst sei er von einem Psychiatriepatienten niedergeschlagen worden, berichtet er. Anschließend habe er große Probleme gehabt, seine Arbeit wie zuvor fortzusetzen. Kollegen und Vorgesetzte hätten sich aber vorbildlich um ihn gekümmert.
In Einrichtungen fehlen Ansprechpartner
Anderenorts ist das offenbar längst nicht überall so: Nur in der Hälfte der deutschen Pflegeeinrichtungen gibt es einer von Tucman vorgestellten Studie zufolge überhaupt einen festen Ansprechpartner, an den sich Mitarbeiter nach Gewalterlebnissen wenden können. Eine intensive Begleitung von Opfern wünschen sich viele, in der Realität findet sie aber nur in jedem zehnten Fall statt.
Dabei kommen tätliche Angriffe, Beleidigungen oder sexuelle Belästigungen flächendeckend vor. In einer dip-Umfrage gaben rund 14 Prozent der Teilnehmer an, häufig selbst Opfer von Übergriffen zu werden. Zwölf Prozent erklärten außerdem, in ihren Einrichtungen komme es "sehr häufig oder eher häufig" zu Gewalt gegen Patienten.
Der Frankfurter Medizinrechtler Thomas Schlegel glaubt an einen Zusammenhang zwischen überlasteten Pflegekräften, schlechter Personalausstattung und der Häufigkeit von Gewalt in Heimen und Kliniken. "Aggression ist der Kontrapunkt zum Burn-out", sagt er. "Pflegekräfte auf unterbesetzten Stationen sind auf sich selbst gestellt. Sie bekommen keine Hilfe, keinen Rat." Wenn es zu wenig Personal gebe, würden beispielsweise Patienten häufiger gegen ihren Willen mit Medikamenten ruhiggestellt. Ohne ausdrückliche Erlaubnis der Patienten handelten die Pflegekräfte in einer rechtlichen Grauzone, warnt Schlegel.
"Strukturen fördern Gewalt in der Pflege"
Auch der Arzt und Hochschulprofessor Karl Beine gibt den Strukturen des Gesundheits- und Pflegesystems eine Mitverantwortung für die Gewalt in der Pflege. Der Wissenschaftler hat sich intensiv mit den wohl gravierendsten Gewalttaten in Pflegeeinrichtungen beschäftigt und alle zehn Tötungsserien der vergangenen Jahrzehnte im deutschsprachigen Raum untersucht. Menschen wie der Krankenpfleger Niels H., der in Oldenburg und Delmenhorst wohl über 90 Patienten ermordet hat, hätten nur deshalb teilweise über Jahre hinweg töten können, weil Hinweise lange ignoriert worden seien.
Manche der Täter hätten im Kollegenkreis nämlich schon lange vor ihrer Festnahme prägnante Spitznamen wie "Todesengel" oder eben "Niels mit einem Sensenmann" erhalten. Der Wissenschaftler warnt davor, dass in einem von "erbarmungslosem Wettbewerb" geprägten Gesundheitssystem solche Taten vertuscht werden, wie es mehrfach versucht worden sei. "Wahrheit darf nicht zum Wettbewerbshindernis werden", fordert er.
Pflege
Bundesregierung
36.000 Stellen in Heimen und Kliniken unbesetzt

epd-bild/Jörn Neumann
Berlin (epd). Den Angaben der Regierung zufolge fehlten im Jahr 2017 in der Altenpflege 15.000 Fachkräfte und 8.500 Helfer. Der Pflegekritiker Claus Fussek bezweifelt, dass es nur 36.000 unbesetzte Pflegestellen sind. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Berufsverband für Pfegeberufe. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sieht die Verantwortung für die Misere auch bei den Arbeitgebern.
In der Krankenpflege gibt es danach 11.000 offene Fachkräftestellen und 1.500 unbesetzte Helfer-Jobs. Die Regierung beruft sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote in der Altenpflege lag bei 0,7 Prozent. Zum Vergleich: Bundesweit über alle Berufsgruppen betrug die Arbeitslosenquote im März 5,5 Prozent. In der Altenpflege kommen auf 100 offene Stellen bundesweit im Schnitt 21 arbeitslose Fachkräfte. In der Krankenpflege standen 100 offenen Stellen durchschnittlich 41 arbeitslose Fachkräfte gegenüber.
Grüne fordern Sofortprogramm
"Es fehlen immer mehr Pflegekräfte, vor allem im ländlichen Raum", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in Berlin. Deswegen brauche es ein Sofortprogramm. "Die Bundesregierung muss jetzt schnell handeln. Wir brauchen 50.000 zusätzliche Pflegekräfte in der Altenpflege und in den Krankenhäusern", sagte Göring-Eckardt. Die von Union und SPD versprochenen 8.000 zusätzlichen Stellen im Pflegebereich seien nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Die Beauftragte für Pflege der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Baehrens, sagte dagegen, das Sofortprogramm mit 8.000 neuen Fachkraftstellen sei angesichts des leer gefegten Arbeitsmarktes ein realistischer erster Schritt. Sie regte an, "Verbesserungen in einer konzertierten Aktion Pflege auf den Weg zu bringen." Ähnlich äußerte sich auch das Bundesgesundheitsministerium: "Wir gehen davon aus, dass diese 8.000 Stellen besetzt werden können", sagte ein Sprecher.
Weidner: Es fehlen mindestens 50.000 Stellen
Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung hält die genannte Zahl von 36.000 offenen Stellen für zu niedrig. "Nach unseren Daten gibt es alleine in Altenheimen und ambulanten Diensten bereits mindestens 38.000 unbesetzbare Stellen, hinzu kommen noch mindestens 10.000 nicht besetzbare Stellen im Krankenhausbereich", sagte Direktor Frank Weidner am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Wir sollten zurzeit von rund 50.000 unbesetzbaren Stellen in der Pflege in Deutschland ausgehen." Es gebe quasi keine Arbeitslosigkeit mehr unter Pflegekräften.
"Diese Zahlen sind nur die Spitze des Eisberges, denn wir wissen, dass die meisten Arbeitgeber ihre freien Stellen gar nicht mehr bei der Bundesagentur melden, da diese nicht mit Arbeitssuchenden helfen können", sagte Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. "Hinzu kommt, dass die nicht besetzten Stellen auf der Basis viel zu niedriger Stellenpläne berechnet werden." Gebraucht würden insgesamt mindestens 100.000 Stellen mehr. "In der Summe sprechen wir also von einem Mangel von deutlich über 126.000 Stellen in der professionellen Pflege."
Im Radioprogramm SWR sagte der Pflegeexperte Claus Fussek zu den fehlenden Fachkräften: "Ich befürchte, dass die Zahlen deutlich höher sind. Eine zweite unbequeme Wahrheit ist, dass unter den Mitarbeitern, die jetzt tätig sind, ein sehr großer Prozentanteil ungeeignet ist für diesen Beruf." Von diesen Mitarbeitern müssten sich Pflegeeinrichtungen trennen.
Linke: Pflegeberuf ist nicht attraktiv genug
Die Linken-Politikerin Pia Zimmermann beklagte, dass die jüngsten Pflegestärkungsgesetze "allesamt zu Lasten der Pflegekräfte gingen". Die Fachkräfte litten seit Jahren nicht nur unter unterirdisch schlechter Bezahlung, sondern auch unter schlechten Arbeitsbedingungen. All das mache "die Pflegeberufe leider wenig attraktiv".
Die aktuellen Zahlen zum Fachkräftemangel überraschen nicht", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Dafür seien in erster Linie die Arbeitgeber verantwortlich. "Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser und Pflegeheimbetreiber auf Kosten der Pflegekräfte sparen und sogar ihren Profit steigern." Schließlich seien in den Krankenhäusern über Jahre zusätzliche Arztstellen entstanden, während Pflegestellen abgebaut worden seien.
Die Diakonie in Niedersachsen rief ebenfalls die Politik zum Handeln auf. Es reiche nicht, 8.000 neue Pfleger einstellen zu wollen, sagte der Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke in Hannover dem Evangelischen Pressedienst (epd). Nötig seien attraktive Arbeitsbedingungen, die dazu führten, "dass Menschen den Beruf in der Pflege ergreifen und ihn auch beibehalten". Das Sozialministerium in Hannover erklärte, es liefen bereits mehrere Schritte, um mehr Fachkräfte zu gewinnen.
Pflege
Interview
Forschungsinstitut: Deutschlandweit fehlen 50.000 Pflegekräfte

epd-bild/privat
Köln (epd). "Nach unseren Daten gibt es alleine in Altenheimen und ambulanten Diensten bereits mindestens 38.000 unbesetzbare Stellen, hinzu kommen noch mindestens 10.000 nicht besetzbare Stellen im Krankenhausbereich", sagte Direktor Frank Weidner am 25. April dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Wir sollten zurzeit von rund 50.000 unbesetzbaren Stellen in der Pflege in Deutschland ausgehen."
Er bezeichnete seine Zahlen als realistisch, weil er wisse, dass etwa 30 Prozent der offenen Stellen der Arbeitsverwaltung gar nicht mehr angezeigt werden. Weidner: "Es gibt quasi keine Arbeitslosigkeit mehr unter Pflegekräften, das heißt, wir sprechen auch nicht mehr von 'offenen', sondern von 'unbesetzbaren' Stellen."
Nach Angaben des Professors fehlen inzwischen landesweit Pflegekräfte, darüber hinaus gibt es Regionen, die besonders hart getroffen sind, etwa ländliche Bereiche und einige Großstädte oder auch grenznahe Gebiete, wo Pflegekräfte ins Ausland abwandern.
"Brauchen grundlegend andere Pflegepolitik"
Der Fachkräftemangel nehme inzwischen dramatische Formen an, sagte der Forscher. Daher könne es nicht mehr darum gehen, nur "Engpässe" zu überwinden, sondern "wir brauchen eine grundlegend neue personalbezogene Pflegepolitik in Deutschland, die nachhaltig Verbesserung erreicht".
Weidner verwies darauf, dass sein Institut im vergangenen Jahr dazu bereits einen Masterplan Pflege für Deutschland angeregt habe. Darin werde für massive gemeinsame Anstrengungen für eine bessere Qualifikation geworben, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Vergütung und mehr Wertschätzung in der Pflege. Weidner: "Für die Umsetzung brauchen wir sicherlich ein zusätzliches, milliardenschweres Finanzvolumen."
Pflege
Familie
Überlastet mit pflegebedürftigen Angehörigen

epd-bild/Jörn Neumann
Karlsruhe, Völklingen (epd). Seit zehn Jahren betreut Brigitte Dorwarth-Walter ihre Mutter. Sie kümmert sich um die alltäglichen Dinge wie Einkaufen oder Arztbesuche. Außerdem ist Dorwarth-Walter stellvertretende Geschäftsführerin der Handwerkskammer Karlsruhe. "Das ist einfach sehr viel", sagt sie. Und funktioniere nur, wenn der Arbeitgeber mitmacht.
Das war in diesem Fall so. Die Handwerkskammer Karlsruhe und die SHG Kliniken Völklingen bei Saarbrücken gehören zu Trägern des Otto-Heinemann-Preises. Die bundesweite Auszeichnung verschiedener Krankenkassen wird an Firmen verliehen, die sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege einsetzen.
Handwerkskammer ist seit Jahren dran am Thema
Die Handwerkskammer beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema. In der Kammer arbeiten 140 Mitarbeiter, sie sind im Schnitt 42 Jahre alt. "Deren Eltern sind in einem Alter, in dem sie tendenziell Hilfe benötigen", sagt Dorwarth-Walter. Derzeit pflegen sieben Mitarbeiter einen Angehörigen, bei einigen anderen ist absehbar, dass es auf sie zukommt.
Laut Dorwarth-Walter ist eine Pflege nur möglich, wenn die Arbeitszeiten flexibel sind. Grundsätzlich gibt es in der Kammer eine Gleitzeit zwischen 7 und 19 Uhr und die Möglichkeit, Arbeiten für die Firma auch zu Hause zu erledigen. Zudem können Mitarbeiter ihr Arbeitszeitkonto von minus 30 bis plus 30 Stunden selbst verwalten.
Außerdem ist Job-Sharing möglich. Das bedeutet, dass sich zwei Personen eine Vollzeitstelle teilen. "Uns ist wichtig, dass das Büro während der Arbeitszeit besetzt ist", erklärt Annette Backes, Personalverantwortliche bei der Handwerkskammer. "Wer wann wie arbeitet, besprechen die Mitarbeiter unter sich."
Auch Umgang mit eigenen Gefühlen klären
Doch Pflege eines Angehörigen ist für die Betroffenen nicht nur eine Frage der Organisation, sondern auch des Umgangs mit eigenen Gefühlen. Wenn der Vater, möglicherweise völlig unerwartet, zu einem Pflegefall werde, seien zahlreiche Menschen in seiner Umgebung verunsichert. Die Kammer hat daher zwei Mitarbeiter zu sogenannten Pflegelotsen ausgebildet. Sie sollen erste Ansprechpartner sein. "Wir haben hierfür bewusst keine Führungskräfte ausgewählt", sagt Backes. Jeder Mitarbeiter solle sich frei fühlen, bei den Pflegelotsen sein Herz ausschütten zu können.
Für fachliche Fragen bietet die Kammer die kostenlose Teilnahme an einem "Kompetenztraining Pflege" an. Die Mitarbeiter der Kammer und weitere Interessenten aus anderen Firmen lernen in 16 Stunden das Wichtigste zur Beantragung von Pflegegraden, Rechtslage und Leistungen.
Martina Koch von den SHG-Kliniken Völklingen hat die Erfahrung gemacht, dass die Pflege der Eltern ein Tabuthema ist. Der Bereich "Vereinbarkeit Familie & Beruf" der Kliniken müsse deshalb seine Angebote aktiv bewerben, sagt Koch. Zu den Angeboten zählt ein Seniorenbegleitdienst, der für pflegebedürftige Angehörige eines Mitarbeiters Rezepte aus der Apotheke abholt oder ihn zum Hausarzt fährt.
Breites Netzwerk bündelt Hilfsangebote
Zum anderen gibt es ein "Internes Pflegenetzwerk". "Als Kliniken haben wir viele Experten, die unsere Mitarbeiter ansprechen können", sagt Koch. Dazu gehören der Schwerbehindertenbeauftragte, das Palliativ-Team, das Ethikkomitee, die Seelsorger und der Sozialdienst. "Wir wollen die Mitarbeiter schon früh unterstützen", sagt Koch, "nicht erst, wenn sie nicht mehr können."
Denn der Stress fange nicht erst an, wenn ein Elternteil bettlägerig ist, erklärt Koch. "Schon sehr viel früher, heißt es oft 'Kannst du bitte mal schnell die Fenster putzen?' oder 'Kannst du schnell noch etwas zum Essen kochen. Beim Pflegedienst schmeckt es nicht so gut.'" Diese kleinen Hilfen summieren sich im Laufe der Zeit aber immer weiter - bis es für den Einzelnen zu einer Überforderung wird.
sozial-
Flüchtlinge
Ermittlungen wegen Korruption bei Asyl-Anerkennung

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin, Bremen (epd). Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist es bei der Erteilung von Asylanerkennungen möglicherweise zu einem schweren Fall von Korruption gekommen. Die Bundesregierung bestätigte am 20. April in Berlin Ermittlungen gegen eine Bremer Beamtin. Über den Fall hatten als erste der NDR, Radio Bremen und die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte eine unabhängige Untersuchungskommission an.
"Die Kommission könnte ein hoher ehemaliger Richter oder der Bundesrechnungshof leiten", sagte Seehofer der am 22. April erschienenen "Bild am Sonntag". Die Kommission solle klären, ob es organisatorische Mängel durch das Fehlverhalten Einzelner gebe. Der Fall in Bremen müsse von Polizei und Justiz aufgeklärt werden.
"Für Recht und Ordnung sorgen"
"Aber es ist Sache der Bundesregierung, bei den Asylverfahren für Recht und Ordnung zu sorgen, so dass mögliche Fehler in der Gegenwart und Zukunft nicht passieren", sagte Seehofer. Kommunalpolitiker könnten sich in Zukunft bei Ungereimtheiten in Asylverfahren auch direkt an ihn wenden, so der Minister.
Nach jüngsten Informationen sollen in der Bremer Außenstelle des Bundesamts zwischen 2013 und 2017 bis zu 2.000 Asylanträge ohne rechtliche Grundlage positiv beschieden worden sein. Politiker von SPD, Grünen und AfD forderten Aufklärung. Das Bundesamt für Migration war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin, das Bundesamt für Migration habe gegen die leitende Mitarbeiterin selbst Strafanzeige erstattet. Das Amt arbeite eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Die Beamtin sei von ihren Dienstpflichten entbunden worden. Weitere Einzelheiten wollte die Sprecherin unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht nennen.
Seibert sieht "erhebliche Verdachtsmomente"
Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von "erheblichen Verdachtsmomenten". Zunächst müsse man die Ermittlungen der Justiz abwarten. Über mögliche politische Konsequenzen könne erst danach gesprochen werden.
Nach Angaben der Bremer Staatsanwaltschaft geht es um "den Vorwurf der bandenmäßigen Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstellung sowie um Bestechung und Bestechlichkeit". Ermittelt werde gegen die Beamtin, drei Rechtsanwälte aus Bremen, Oldenburg und Hildesheim und einen Dolmetscher, mit denen die Frau offenbar zusammengearbeitet habe, erläuterte eine Sprecherin. Die Ermittlungen liefen bereits seit längerem. Verhaftungen habe es noch nicht gegeben.
Der Sprecherin zufolge wurden acht Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht, darunter auch zwei Rechtsanwaltskanzleien. Die Bremer Beamtin habe offenbar mit drei Anwälten zusammengearbeitet, die ihr systematisch Asylsuchende zugeführt hätten. Dabei seien die Asylsuchenden, meist Jesiden, nicht aus Bremen gekommen, sondern aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Jesiden sind eine kurdische religiöse Minderheit, die vor allem im nördlichen Irak und in Nordsyrien lebt.
Die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge war nach Informationen der Bremer Staatsanwaltschaft formal für die Asylsuchenden gar nicht zuständig. Die Leiterin habe in Eigenregie entschieden und die Anträge durchgewunken, hieß es.
Verdächtige soll Zuwendungen erhalten haben
Noch sei nicht klar, ob und wie die Beamtin oder die Anwälte mit der Sache Geld verdient hätten. Die ehemalige Mitarbeiterin soll zumindest Zuwendungen, etwa in Form von Restaurant-Einladungen, erhalten haben.
SPD und Grüne forderten von der Bundesregierung Aufklärung. Die Glaubwürdigkeit von Asylentscheidungen gerate durch die schlechte interne Organisation des Bundesamts in Misskredit, kritisierte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg. Demgegenüber erklärte die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel, es müsse überprüft werden, ob es auch woanders Fälle wie in Bremen gäbe. Die Asylanträge müssten neu geprüft werden. Wer dann womöglich ausreisepflichtig sei, müsse sofort ausgewiesen werden.
Jesiden weisen Vorwürfe zurück
Unterdessen meldete sich auch der Zentralrat der Jesiden zu Wort. Dessen Vorsitzender Irfan Ortac wies die Anschuldigungen gegen Jesiden zurück. Die in Medien aufgestellte Behauptung, Jesiden seien von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach Bremen gebracht worden, um leichter anerkannt zu werden, sei nicht plausibel, sagte er am 23. April in Bielefeld dem Evangelischen Pressedienst (epd).
In den vergangenen Jahren hätten Jesiden aus Syrien generell in Deutschland einen asylrechtlichen Schutz erhalten: "Insofern kann bei Jesiden aus Syrien eine manipulative Asylentscheidung kaum stattgefunden haben." Weder Asylbewerber noch die Außenstellen des Bundesamtes könnten durch den Ort der Antragstellung den künftigen Wohnort beeinflussen, sagte Ortac. Dafür seien die zentralen Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig.
Abtreibung
SPD und Verbände dringen auf Entscheidungen im Abtreibungs-Streit
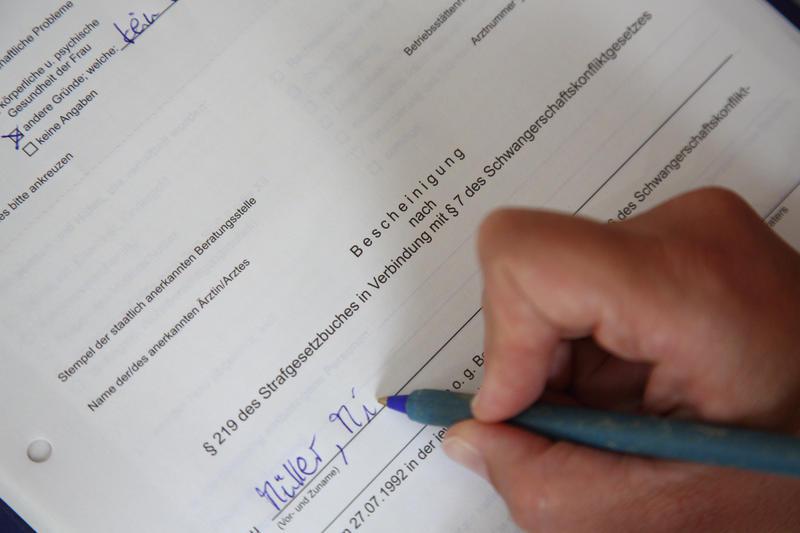
epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). In der Auseinandersetzung um das Werbeverbot für Abtreibungen wächst aufseiten der Gegner die Ungeduld. Ein Verbände-Bündnis fordert in einem Offenen Brief an die Bundesregierung und die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, den Strafrechtsparagrafen 219a abzuschaffen. Der SPD-Parteivorstand dringt auf eine Lösung des Konflikts bis zum Herbst. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)erklärte in der "Bild"-Zeitung am 24. April, dass Frauen sich informieren könnten, sei auch erreichbar, ohne Gesetze zu ändern.
Sollte bis zum Herbst mit der Union kein Kompromiss über eine Gesetzesänderung gefunden worden sein, müsse die Abstimmung im Bundestag freigegeben werden, heißt es in einem Beschluss des Parteivorstands vom 23. April.
In diesem Fall wäre eine Mehrheit für eine Reform des Paragrafen 219a oder dessen Abschaffung wahrscheinlich. In dem Vorstandsbeschluss werden die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass gesetzliche Änderungen verabschiedet werden. Ärzte müssten straffrei über Schwangerschaftsabbrüche informieren können und das Informationsrecht für schwangere Frauen müsse gewährleistet werden.
Gießener Ärztin zu Geldstrafe verurteilt
Der Paragraf 219a stellt die Werbung für und die Ankündigung von Abtreibungen unter Strafe. Ende 2017 war eine Gießener Ärztin verurteilt worden, weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis darüber informiert hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Linkspartei, Grüne und SPD wollen den Paragrafen abschaffen. Die SPD verhandelt mit der Union über einen Kompromiss. CDU und CSU wollen am Werbeverbot festhalten.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat ihren Antrag auf Streichung des Paragrafen 219a aus Rücksicht auf die Union bisher nicht in den Bundestag eingebracht. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) soll einen Gesetzesvorschlag erarbeiten.
Verbände fordern freien Informationszugang
Sozial- und Frauenverbände sowie Gewerkschaften und Fachverbände wie pro familia forderten einen freien Zugang zu Informationen über Abtreibungen. Angesichts zahlreicher Klagen gegen Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, dränge die Zeit. Schwangere Frauen in einer Notlage müssten das Recht auf umfassende Information sowie die freie Arztwahl haben, erklärte der Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler.
Im Einzelnen wenden sich die Verbände an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU), Justizministerin Barley und Familienministerin Franziska Giffey (bei SPD), die zuletzt eine Reform des Paragrafen 219a gefordert hatte.
Grüne stehen an der Seite der Verbände
Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Ulle Schauws, unterstützte den Aufruf der Verbände. Die Regierung aus Union und SPD dürfe das Thema nicht weiter verschleppen. Schauws hatte schon im vergangenen Jahr die Fachpolitiker im Bundestag zu Gesprächen eingeladen. Sie sagte, die SPD dürfe sich nicht mit einer Scheinlösung abfinden, die den Schwangeren und der Ärzteschaft umfassende Informationsrechte vorenthalte.
Sabine Weiss, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, will am Werbeverbot festhalten: "Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein ärztlicher Eingriff wie jeder andere. Wenn Frauen sich damit auseinandersetzen, befinden sie sich in einer schwierigen Lage und dürfen nicht alleine gelassen werden. Sie brauchen alle notwendigen Informationen, um in dieser Ausnahmesituation eine informierte Entscheidung treffen zu können. Dafür müssen wir aber nicht den Paragrafen 219a StGB abschaffen."
Das Werbeverbot sei Teil eines ausgewogenen Konzepts für den Schutz des ungeborenen Lebens, auf das man sich vor über 25 Jahren nach langen gesellschaftlichen Debatten geeinigt hat. Diese Entscheidung wurde wohlüberlegt getroffen. Eine Novellierung des Strafgesetzbuchs sei deshalb der falsche Weg.
Abtreibung
Ärzte
Kammer-Chef Henke: Paragraf 219a soll bleiben

epd-bild/Jochen Rolfes/Ärztekammer Nordrhein
Berlin (epd). Henke sagte dem epd, er halte das Werbeverbot weiter für gerechtfertigt. Wer als Arzt im Internet über Abtreibungen informiere und erkennen lasse, dass er sie durchführe, nutze seine Homepage "als elektronische Form einer Litfaßsäule". Ein Schwangerschaftsabbruch sei aber "keine ärztliche Leistung wie jede andere." Er sehe daher auch nach dem Urteil gegen eine Gießener Ärztin keine Notwendigkeit für eine Reform des Paragrafen 219a.
Die Hamburger Ärztekammer hatte in der vergangenen Woche als erste berufsständische Vertretung in einer einstimmig gefassten Resolution die Streichung des Paragrafen 219a gefordert. Sie ging damit weiter als andere Landesärztekammern.
Auslöser war der Fall Kristina Hänel
Die Gießener Ärztin Kristina Hänel war im November 2017 zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf der Webseite ihrer Praxis über Abtreibungen informiert hatte. Das Urteil löste eine Debatte über den Paragrafen 219a aus, der Werbung für Abtreibungen in anstößiger Weise oder des geschäftlichen Vorteils wegen verbietet. Dem Bundestag liegen Anträge zur Streichung oder Überarbeitung des § 219a vor. Die Union will den Paragrafen beibehalten.
Henke, der für die CDU im Bundestag sitzt, erklärte, das Werbeverbot behindere die Aufklärung von Patienten nicht. Wenn eine Schwangere einen Abbruch vornehmen lassen wolle, könne und müsse der Arzt sie über den Eingriff und mögliche Gefahren aufklären, damit sie eine eigenständige Entscheidung treffen könne.
Henke sprach sich auch dafür aus, Frauen, die sich nach der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung für den Abbruch einer Schwangerschaft entscheiden, Adressen von Ärzten auszuhändigen, die Abtreibungen ausführen. Diese wiederum könnten ihrerseits die Beratungsstellen darüber informieren, dass sie Abbrüche machen. Ärzte hingegen, die sich über ihre Homepage direkt an die Öffentlichkeit wendeten, "schlagen einen Bypass zur gesetzlich vorgeschriebenen regulierten Beratung", kritisierte Henke.
Erstaunt über "emotionale Debatte"
Er zeigte sich erstaunt, dass das Gießener Urteil "eine solch emotionale Debatte" ausgelöst habe. Ärzte hätten sich an das geltende Recht zu halten. Eine sachliche, individuelle Information sei keine Werbung, betonte Henke: "Ich sehe keine fachliche Notwendigkeit für eine politisierte Kontroverse darüber."
Damit ging er als Landesärztekammer-Präsident auf Distanz zum Präsidenten der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery. Montgomery hatte in seiner zweiten Funktion als Ärztekammer-Präsident in Hamburg die Resolution zur Streichung des Paragrafen 219 a unterstützt.
Bundesregierung
Giffey: Kita-Qualitätsgesetz noch in diesem Jahr
Berlin (epd). Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will noch in diesem Jahr ein Gesetz zur Qualität der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege in die parlamentarische Beratung einbringen. Das kündigte sie am 25. April vor dem Familienausschuss des Bundestages an. Ziel des Gesetzes sei es, bundesweit gültige Qualitätskriterien für die Kinderbetreuung festzulegen und die Gebühren für Kitas zu senken.
Gemeinsam mit den Ländern habe man sich auf verschiedene Instrumente, etwa beim Betreuungsschlüssel, geeinigt, erläuterte die Ministerin aus. Vorbereitet werden soll demnach in diesem Jahr auch die Verankerung auf Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter im Achten Buch Sozialgesetzbuch.
Dieses Vorhaben werde allerdings noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sagte Giffey. In die Ressortabstimmung zwischen den zuständigen Ministerien soll zudem die geplante Erhöhung des Kinderzuschlags gehen. Es sei ein "Fehlanreiz", wenn der Kinderzuschlag gänzlich wegfalle, wenn eine Mutter sich entschließe, etwas mehr zu arbeiten und so auch mehr zu verdienen, sagte Giffey. Diese "harte Abbruchkante" solle nach ihrem Willen durch ein stufenweises Abschmelzen des Kinderzuschlages ersetzt werden.
Ministerin Giffey kündigte an, die sozialen Berufe in Deutschland aufwerten zu wollen. In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium werde man deshalb ein Gesetz auf den Weg bringen, um die Ausbildung, die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung im Pflegebereich zu verbessern. Geplant sei eine kostenfreie Ausbildung beziehungsweise Umschulung zur Pflegekraft.
Bundesregierung
Resettlement: Deutschland nimmt 10.200 Flüchtlinge auf

epd-bild/Marc Engelhardt
Berlin (epd). 2018 würden 4.600, 2019 weitere 5.600 Schutzsuchende aufgenommen, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach einem Treffen mit EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am 19. April in Berlin. Der Kommissar hatte bereits zuvor bekanntgegeben, dass in dieser Woche die entsprechende Zusage der Bundesregierung in Brüssel eingegangen sei.
Die Kommission will, dass die EU insgesamt 50.000 Flüchtlinge im sogenannten Resettlement aufnimmt. Mit der Zusage Deutschlands werde dieses Ziel erreicht, sagte Avramopoulos. 70 Prozent der Flüchtlinge seien Syrer, der Rest hauptsächlich Afghanen, Iraker und Pakistaner.
Legaler Zugang aus humanitären Gründen
Aus humanitären Motiven werde ein legaler Zugang ermöglicht, sagte Seehofer. Der Minister betonte, dass die zugesagten Plätze in die im Koalitionsvertrag vereinbarte Spanne der Gesamtzuwanderung eingerechnet würden. Union und SPD haben dort festgehalten, dass sich die jährliche Zuwanderung zwischen 180.000 und 220.000 Menschen bewegen soll.
Der UNHCR begrüßte die Ankündigung. Resettlement sei ein wichtiges Instrument. Es richte sich an die Bedürftigsten und Verwundbarsten, erklärte der Berliner Repräsentant des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, Dominik Bartsch. Das Programm ermöglicht Flüchtlingen in einem Land ohne Perspektive die Umsiedlung in einen sicheren Staat. Vor allem Kranken und Familien soll dabei geholfen werden. Der UNHCR organisiert die Umsiedlung und trifft in Zusammenarbeit mit den Staaten die Auswahl.
EU-Programm im Vorsommer aufgelegt
Die EU-Kommission hatte das Resettlement-Programm im vergangenen Sommer aufgelegt. Die EU unterstützt die Aufnahmeländer mit einer halben Milliarde Euro. Deutschland beteiligte sich auch in der Vergangenheit an den Programmen. 2017 wurden nach Angaben des Innenministeriums rund 3.000 Menschen über das Resettlement nach Deutschland geholt. Die Koalitionspartner hatten wiederholt angekündigt, sich auch künftig an den Programmen zu beteiligen. Die konkrete Zusage ließ wegen der langen Regierungsbildung aber auf sich warten.
Nach Angaben der EU-Kommission beteiligen sich neben Deutschland weitere 19 EU-Mitgliedstaaten am Resettlement-Programm. Frankreich hat eine Zusage für ebenfalls 10.200 Plätze gemacht. Schweden liegt mit einem Angebot für 8.750 Flüchtlinge auf dem dritten Platz der Länder, die die größten Zusagen gemacht haben. Auch einige osteuropäische Länder machten Zusagen für wenige hundert Plätze, darunter Kroatien, Slowenien und Rumänien. Von Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn gibt es nach Angaben der Kommission dagegen weiter kein Angebot, Flüchtlinge aufzunehmen.
Seehofer sagte, es sei gut, das sich die starken Länder beteiligten. Bei den anderen Ländern müsse man "jede Gelegenheit nutzen, um sie zu gewinnen", sagte er. Er sei zuversichtlich, dass es früher oder später eine von allen 27 EU-Ländern getragene Lösung geben werde, sagte der Minister.
EU sucht neue Wege zur Verteilung der Flüchtlinge
Die EU-Regierungen verhandeln derzeit über ein neues gemeinsames Asylsystem, das unter anderem eine andere Verteilung Asylsuchender zur Folge haben soll. Avramopoulos unterstrich in Berlin, dass im Juni ein Ergebnis geben soll.
Die Grünen begrüßten die Zusage der Bundesregierung zum Resettlement. "Tausende traumatisierte Flüchtlinge, gerade Frauen, die in libyschen Lagern vergewaltigt und versklavt werden, warten auf Rettung", erklärte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock. Sie drang auf eine schnelle Umsetzung des Versprechens. Die AfD lehnte die Aufnahme generell ab. Die Bundesregierung solle Zusagen an die EU "unterlassen", erklärte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel.
Nordrhein-Westfalen
Kommunen bekommen vorerst weniger Flüchtlinge zugewiesen
Düsseldorf (epd). Die nordrhein-westfälische Landesregierung will Kommunen künftig möglichst nur anerkannte Flüchtlinge oder Menschen mit guter Bleibeperspektive zuweisen. "Wir wollen die Kommunen spürbar entlasten, damit sie sich grundsätzlich auf die Integration der Personen mit Bleiberecht konzentrieren können", sagte der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am 24. April in Düsseldorf.
Mit einem Asyl-Stufenplan in drei Schritten will die Landesregierung die Steuerung der Asylsuchenden umstellen. Der Plan sieht unter anderem vor, die Asylverfahren zu beschleunigen. Nicht schutzberechtigte Flüchtlinge sollen demnach möglichst schnell aus den Landeseinrichtungen in Heimatländer abgeschoben werden.
Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus sollen statt drei nun bis zu sechs Monate in den Landeseinrichtungen verbleiben. Asylsuchende mit offensichtlich unbegründetem oder unzulässigen Status sollen laut Stamp sogar bis zu 24 Monate in den Unterkünften des Landes bleiben, bevor sie an die Kommunen übergeben werden.
Der NRW-Integrationsminister plant zudem in allen fünf Regierungsbezirken NRWs zentrale Ausländerbehörden. Zu den in Dortmund, Köln und Bielefeld bestehenden sollen demnach Einrichtungen in Essen und Coesfeld hinzukommen.
Nordrhein-Westfalen
Landschaftsverband unterstützt "intelligente" Wohnungen für Behinderte
Münster/Bochum (epd). Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) fördert 15 Pilotprojekte für das selbstständige Wohnen von behinderten Menschen. Das Programm "Selbstständiges Wohnen" (SeWo) setzt auf Unterstützung durch moderne Technik sowie auf die Einbindung ins Stadtviertel oder in die Dorfgemeinschaft, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am 25. April in Bochum erklärte. Rund 200 Wohnungen sollen in Westfalen-Lippe entstehen, die der Landschaftsverband mit insgesamt zehn Millionen Euro fördert.
Bei den Projekten soll intelligente Technik den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder der Bedienung der Haustechnik helfen. "Schlaue, aber nicht unbedingt teure Technik" solle dabei mit von Quartiersmanagern geförderter "guter Nachbarschaft" kombiniert werden, erläuterte LWL-Direktor Matthias Löb.
Unter den geförderten Wohnmodellen sind Projekte der Diakonie Ruhr in Bochum, der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld und der Diakonischen Stiftung Wittekindshof im Kreis Minden-Lübbecke.
Der Witekindshof will nach eigenen Angaben einen Neubau mit zwölf bis 15 Einzelappartements errichten: "Noch suchen wir einen Bauplatz. Wir planen eine barrierefreie und rollstuhlgerechte Hauswohngemeinschaft, um ein Wohnumfeld zu schaffen, das viel Selbständigkeit und ein hohes Maß an Unterstützung ermöglicht, aber auch aktiv in das Leben der Stadt eingebunden ist", erklärte Diakon Burkhard Hielscher, der für die Wittekindshofer Wohnangebote im Altkreis Lübbecke verantwortlich ist.
Als SeWo-Projekt könne eine besondere technische Ausstattung möglich werden wie etwa modernste Haustechnik, computerunterstützte virtuelle Lernfelder, oder auch besondere Hilfsmittel, um behinderungsbedingte Barrieren zu überwinden.
Die Hauswohngemeinschaft soll ein Anschlussangebot sein für die spezialisierte Wohngruppe für Menschen mit Behinderung und Adipositas in Lübbecke und für die spezialisierten Wohngruppen für Menschen mit dem seltenen Prader-Willi-Syndrom, das mit einer leichten geistigen Behinderung, angeborener Esssucht und herausforderndem Verhalten verbunden ist.
Behinderung
Bund lenkt im Streit um Bahnsteighöhen ein
Mainz (epd). Der Bund hat in der Debatte um eine angestrebte bundesweit einheitliche Bahnsteighöhe eingelenkt. Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe sich mit der Deutschen Bahn AG darauf geeinigt, dass in Rheinland-Pfalz weiter auf Grundlage eines Landeskonzepts geplant und gebaut werden könne, teilte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am 24. April in Mainz mit. Der Bund nehme Abstand von seiner Forderung, dass auch im Nahverkehr alle Bahnsteige in Deutschland langfristig auf eine Höhe von 76 Zentimetern angepasst werden sollten.
Unmut über das Konzept des Bundes hatte es auch in anderen Landesregierungen gegeben, die sich frühzeitig selbst Gedanken über die Barrierefreiheit im Schienenverkehr gemacht hatten. Nach Angaben des Mainzer Verkehrsministeriums ist Rheinland-Pfalz eines der ersten Länder, das eine Einigung aushandeln konnte. "Jetzt haben wir endlich wieder Planungssicherheit und können die Bahnsteige mit für den Nahverkehr in der Fläche sinnvollen 55 Zentimetern weiter ausbauen", sagte Wissing über die Einigung.
Die Pläne des Bundes waren in Rheinland-Pfalz auf scharfen Widerstand gestoßen, weil das Vorhaben nicht wie vom Bund erhofft für mehr, sondern für weniger Barrierefreiheit bei der Eisenbahn gesorgt hätte. In Rheinland-Pfalz wird seit Jahren ein mit der Bahn abgestimmtes Konzept verfolgt, das im Regionalverkehr überwiegend eine einheitliche Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern anstrebt. Bei Modernisierungen von Bahnhöfen wurden die Bahnsteige entsprechend umgebaut.
Hätte der Bund sich mit seiner Forderung durchgesetzt, wäre die Auszahlung von Fördergeldern an die neue Bahnsteighöhe gekoppelt worden. Die Landesregierung hatte befürchtet, dies könnte den barrierefreien Umbau der Bahnstationen zum Stocken bringen.
Bayern
Regierung bessert Psychiatriegesetz nach

epd-bild/Werner Krüper
München/Nürnberg (epd). Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) kündigte am 24. April bei der Kabinettssitzung an, man wolle eine zunächst geplante Datenspeicherung in einer Unterbringungsdatei vollständig zurücknehmen. "Wir nehmen die Ängste und Sorgen der Betroffenen sehr ernst", erklärte Schreyer laut einer Mitteilung der Staatskanzlei.
Bei einer Expertenanhörung zum Gesetz am 24. April im Ausschuss für Gesundheit und Pflege erntete der Entwurf des PsychKHG weiter Kritik. So erklärte der Vertreter des paritätischen Wohlfahrtsverbands Davor Stubican, das Gesetz erwecke den Eindruck, als müsse der Staat "schwere Geschütze" gegen gefährliche psychisch Kranke auffahren. Ziel müsse vielmehr sein, die Zahl der Unterbringungen von psychisch Kranken zu senken.
"Heilung ist die beste Gefahrenabwehr"
Der Präsident des Bayerischen Bezirkstags, Josef Mederer (CSU), unterstrich, "wir wollen Menschen helfen und heilen und sie nicht wegsperren". Heilung sei die "beste Gefahrenabwehr". Betroffene und angehörige warnten vor einer Stigmatisierung von psychisch kranken Patienten.
Laut Mitteilung aus dem Kabinett sollen die Verweise auf den Maßregelvollzug ebenfalls aus dem Gesetz gestrichen werden. Auch mit der Sprache des PsychKHG wolle man den Belangen der psychisch Kranken besser Rechnung tragen, kündigte Schreyer an.
Gegen das PsychKHG waren Verbände und Betroffene Sturm gelaufen. Aber auch CSU-Politiker kritisierten, der Entwurf helfe psychisch Kranken nicht, sondern fördere die Angst der Betroffenen vor der Psychiatrie und stempele sie ab zu potenziellen Straftätern. Das Gesetz konzentrierte sich zu stark auf die Aspekte der Gefahrenabwehr und Sicherheit und zu wenig auf die für die Erkrankten nötigen Hilfsangebote und Hilfestellungen, sagten unter anderem Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und Betroffenenverbände. Positiv werteten sie nur, dass nach dem Gesetzentwurf ein flächendeckendes Krisennetzwerk geschaffen werden soll.
"Unsere Argumente wurden gehört", sagte der Vorsitzende der Freie Wohlfahrt und Präsident der Diakonie Bayern, Michael Bammessel, in Nürnberg. Das gelte beispielsweise für eine klare Entkoppelung vom Maßregelvollzuggesetz. "Wir freuen uns, dass Sozialministerin Schreyer von Anfang an auf den Dialog mit den Verbänden wert legt."
Diakonie begrüßt neuen Kurs
Auch Diakonie-Pressesprecher Daniel Wagner sagte in einer ersten Reaktion auf die angekündigten Änderungen an dem Gesetz, er freue sich, "dass unsere Forderungen angekommen sind". Dass die Datenspeicherung nicht kommen werde, sei "sehr gut". Man müsse nun noch auf die Details im Gesetz achten, erklärte Wagner.
Wichtig ist nach seinen Worten auch, dass der Gesetzgeber nicht weiter darauf beharre, dass psychisch Kranke auch in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege untergebracht werden können. Nur die Kliniken seien die richtige Unterbringung.
Auch die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bayerischen Landtag, Katrin Sonnenholzner (SPD), lobt die angekündigten Nachbesserung am bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz: In jedem Fall müssten die Unterbringungsdatei und die Verweise auf das Maßregelvollzugsgesetz, also die Gleichsetzung psychisch Kranker, mit Straftätern, vollständig gestrichen werden.
Die Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, erklärte, der bisherige CSU-Entwurf zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz "hätte uns als Gesellschaft um Jahrzehnte zurückgeworfen und psychisch kranke Menschen in die Nähe von Straftätern gerückt". Die sozialpolitische Grünen-Sprecherin Kerstin Celina sagte: "Jeder von uns kann krank werden, jeder von uns kennt jemanden, der psychisch erkrankt war oder war es selbst".
Hamburg
Volksinitiative zum Pflegenotstand kommt zustande
Hamburg (epd). Die Hamburger "Volksinitiative gegen Pflegenotstand in Krankenhäusern" hat die notwendige Zahl von 10.000 gültigen Unterschriften erreicht. Damit sei die Volksinitiative zustande gekommen, teilte die Innenbehörde am 24. April mit. Bis zum 27. September muss sich nun die Bürgerschaft mit dem Thema befassen. Lehnt sie es ab, müssen für das anschließende Volksbegehren innerhalb von drei Wochen mehr als 60.000 Unterschriften neu gesammelt werden. Ist auch das Volksbegehren erfolgreich, kommt es zu einer Volksabstimmung.
Mit der Volksinitiative will ein Hamburger Bündnis Verbesserungen in der Krankenhaus-Pflege erreichen. Nach Berechnungen der Gewerkschaft ver.di fehlen rund 4.200 Stellen in Hamburgs Krankenhäusern. Die Mehrkosten werden auf 128 Millionen Euro geschätzt. Konkreter Gegenstand der Volksinitiative ist ein Gesetzentwurf zur Änderung des Hamburgischen Krankenhausgesetzes, der Vorschriften über die Gebäudereinigung, der Bemessung von Pflegepersonal und der Bestimmungen zu Investitionskosten.
Politisch umstritten ist die Volksinitiative, weil im Koalitionsvertrag von Union und SPD bereits eine Verbesserung der Pflege vorgesehen ist. Nach Angaben der Initiatoren sind die Vereinbarungen wenig konkret. Denkbar sei jedoch, dass sich bei einer positiven Entwicklung die Volksinitiative erübrige.
Baden-Württemberg
Karlsruhe richtet ersten Drogenkonsum-Raum ein
Karlsruhe (epd). Die Stadt Karlsruhe richtet den ersten Drogenkonsumraum in Baden-Württemberg ein. Dies entschied der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe einstimmig am 24. April. Der Drogenkonsumraum soll als Erweiterung des Kontaktladens "Get In" der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zum 1. Januar 2019 eingerichtet werden. Die Maßnahme sei zunächst auf drei Jahre befristet und werde jährlich mit 197.000 Euro bezuschusst.
Ein Drogenkonsumraum biete Abhängigen die Möglichkeit mitgebrachte Substanzen unter Einhaltung bestimmter Regeln unter hygienischen und sicheren Bedingungen einzunehmen, heißt es in dem Antrag. Ziel sei es, Infektionen, Überdosierungen und Todesfälle zu verhindern. Damit soll auch der öffentliche Raum entlastet werden und die soziale Integration von Drogenkonsumenten zu erleichtern. Wie auch bundesweit, sei die Zahl der Drogentoten in den letzten Jahren angestiegen. 2017 gab es in Karlsruhe 10 Drogentodesfälle.
Damit das Angebot realisiert werden kann, muss das Land Baden-Württemberg eine entsprechende Verordnung erlassen. Rechtliche Grundlagen für solche Drogenkonsumräume gibt es in sechs Bundesländern (Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saarland), heißt es weiter. Bundesweit gibt es 23 Drogenkonsumräume in 16 Städten.
sozial-
Kirchen
Arbeit
"Bewertungen durch staatliche Gerichte sind problematisch"

epd-bild/VdDD
Berlin (epd). Nach dem Urteil des EuGH zum "Fall Egenberger" müssen diakonische Einrichtungen in Zukunft das Verlangen einer Kirchenmitgliedschaft in Ausschreibungen vor staatlichen Gerichten nachvollziehbar begründen können. Vera Egenberger wurde als konfessionelle Stellenbewerberin vom Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung im Jahr 2012 abgelehnt - und ging daraufhin vor Gericht. Beim EuGH hat sie am 17. April einen Etappensieg erzielt. VdDD-Hauptgeschäftsführer Ingo Dreyer findet es "problematisch, wenn nun die staatlichen Gerichte innerkirchliche Angelegenheiten nach Vorgaben des EuGH bewerten sollen". Die Fragen stellte Markus Jantzer.
epd sozial: Wie bewerten Sie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach Kirchen und kirchliche Einrichtungen nicht mehr von jedem Stellenbewerber eine Religionszugehörigkeit fordern dürfen?
Ingo Dreyer: Der EuGH hat in seinem Urteil das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und der ihnen zugeordneten Einrichtungen im Grundsatz zwar bestätigt. Aber das Urteil steht im Widerspruch zu Artikel 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Darin ist geregelt, dass die EU die rechtliche Stellung der Religionsgemeinschaften in den Mitgliedsstaaten achtet und sie nicht beeinträchtigt. Mit dem Urteil greift der EuGH in diese rechtliche Stellung ein, indem er dem verfassungsrechtlich geschützten Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nicht umfassend Geltung verschafft. Denn – anders als die bisherige höchstrichterliche deutsche Rechtsprechung – zieht er die Verkündungsnähe der Tätigkeit als Beurteilungsmaßstab heran. Zum Selbstbestimmungsrecht der Kirchen muss aber auch gehören, dass sie eigenverantwortlich bestimmen können, inwieweit eine Kirchenmitgliedschaft – auch unabhängig von der konkreten Tätigkeit – für die Mitarbeit verlangt werden kann und welches Ethos dafür ausschlaggebend ist.
epd: Begrüßen Sie die juristische Klarstellung?
Dreyer: Im Urteil des EuGH sehe ich keine Klarstellung. Denn einerseits betont das Urteil, dass es staatlichen Gerichten nicht zustehe, über das der angeführten beruflichen Anforderung zugrundeliegende Ethos als solches zu befinden, andererseits benennt es die Kriterien "wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt" für eine Bewertung. Mit diesen Begriffen ist noch nicht viel ausgesagt, sie bedürfen einer Interpretation – und diese wird nun den nationalen Gerichten übertragen. Dabei gab und gibt es gute staatskirchenrechtliche Gründe, warum deutsche Gerichte zwar die Plausibilität der Kirchenvorgaben überprüft, sie aber nicht inhaltlich gewertet haben. Wenn nun die staatlichen Gerichte innerkirchliche Angelegenheiten nach Vorgaben des EuGH bewerten sollen, dann halte ich das für problematisch.
epd: Welche Folgen wird das Urteil in der Praxis haben?
Dreyer: Die ganz konkreten Auswirkungen werden sich erst benennen lassen, wenn das Bundesarbeitsgericht im Ausgangsverfahren entschieden hat. Bis dahin gilt das derzeitige Recht – und damit auch die "Richtlinie des Rates über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie". Diese bietet schon jetzt pragmatische Lösungen, denn sie ermöglicht unter bestimmten Umständen auch die Einstellung von Nichtchristen.
epd: Sehen Sie die Gefahr, dass es für diakonische Einrichtungen schwerer werden wird, ihre christliche Prägung zu bewahren und erkennbar zum Ausdruck zu bringen?
Dreyer: Die christliche Prägung ist unser Markenkern. Sie macht sich an vielen Faktoren fest: Wie wird die Dienstgemeinschaft gelebt? Gibt es seelsorgerische Angebote für Klienten und Mitarbeitende? Werden Glaubenskurse für die Beschäftigten angeboten usw.? Es ist die Summe unterschiedlicher Maßnahmen, die für das besondere evangelische Profil entscheidend sind. Und natürlich gehört dazu auch, ob und wie viele Mitarbeitende Christen sind. Schon heute sind aber auch Nichtchristen eingeladen, sich am Auftrag der Diakonie zu beteiligen.
epd: Welche Reaktionen erwarten Sie nun von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) - etwa mit Blick auf die zum 1.1.2017 reformierte Loyalitätsrichtlinie - und dem Bundesverband der Diakonie?
Dreyer: Die EKD und die Diakonie Deutschland haben angekündigt, die Urteilsgründe sorgfältig zu prüfen, die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts abzuwarten und – je nach Ausgang des Urteils – zu überprüfen, inwieweit die Entscheidung mit dem deutschen Religionsverfassungsrecht vereinbar ist. Diese Herangehensweise halten wir für angebracht und unterstützen eine sachliche Analyse.
Kirchen
Arbeit
Weitere Öffnung für nichtkonfessionelle Jobbewerber
Die evangelischen Kirchen in der Pfalz, in Hessen-Nassau und in Kurhessen-Waldeck werden nach einem EuGH-Urteil zukünftig mehr nichtkirchliche Bewerber beschäftigen müssen. Sie betonen jedoch deren Treuepflicht gegenüber den Inhalten der Kirche.
Speyer, Darmstadt, Kassel (epd). Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum kirchlichen Arbeitsrecht in Deutschland wird die Einstellungspraxis der pfälzischen und der kurhessischen Landeskirche verändern. Kaum Auswirkungen auf ihr Vorgehen sieht hingegen die hessen-nassauische Kirche. Dies machten Vertreter der drei Landeskirchen gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) deutlich. Der EuGH in Luxemburg hatte am 17. April entschieden, dass kirchliche Arbeitgeber nicht pauschal und unbegründet eine Kirchenmitgliedschaft bei Bewerbern verlangen dürfen.
Fünf Prozent der Beschäftigten keine Christen
Der Gerichtshof habe zwar deutlich gemacht, dass es staatlichen Gerichten nicht zustehe, über das religiöse Ethos der Religionsgemeinschaften zu befinden, sagte der pfälzische Oberkirchenrats Dieter Lutz in Speyer. Zukünftig müssten aber die Kirchen verstärkt erklären, ob ein Arbeitnehmer mit diesem Ethos überhaupt in Berührung komme. Ortskirchengemeinden und die Landeskirche seien von dem Urteil wahrscheinlich weniger betroffen als die Unternehmensdiakonie, sagte der für das nichttheologische Personal zuständige Oberkirchenrat.
Bereits jetzt seien etwa fünf Prozent der in der pfälzischen Landeskirche arbeitenden Menschen keine Christen, sagte Lutz. In einem Gesetzentwurf für die im Mai in Kaiserslautern tagende Landessynode sei vorgesehen, die Möglichkeiten, solche Mitarbeiter in der Kirche zu beschäftigen, zu erweitern. Es müsse nun abgewartet werden, wie das Bundesarbeitsgericht die Entscheidung der Luxemburger Richter umsetze, sagte der Kirchenjurist. Ein Gang zum Bundesverfassungsgericht gegen die Entscheidung des EuGH sei allerdings wenig erfolgversprechend.
Anforderungen an Bewerber
Für die kurhessische Kirche (EKKW) kommt das Luxemburger Urteil zur Kirchenmitgliedschaft von Bewerbern für eine kirchliche Arbeitsstelle nicht überraschend. Die Abwägung persönlicher Rechte von Bewerbern mache auch vor dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht nicht halt, sagte die Dezernentin für Arbeits- und Schulrecht, Anne-Ruth Wellert, in Kassel. Künftig würden kirchliche Arbeitgeber vor einer Stellenausschreibung auf Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes prüfen müssen, welche Anforderungen an die Bewerber zu stellen sind.
"Es wird nach innen und nach außen stärker als bisher erforderlich sein, das kirchliche Ethos im Hinblick auf die Beschäftigung von Mitarbeitenden deutlich zu machen und unterschiedliche Anforderungen für verschiedene Berufsgruppen und Aufgaben zu postulieren", sagte Wellert. In der EKKW gelte bisher die Loyalitätsrichtlinie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Diese setze für Bewerber grundsätzlich die Mitgliedschaft zur evangelischen Kirche voraus. Wenn kein evangelischer Mitarbeiter gewonnen werden könne, genüge ausnahmsweise auch die Mitgliedschaft in einer Kirche, die zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zähle.
EKHN: Urteil hat kaum Auswirkungen
Die hessen-nassauische Kirche sieht hingegen durch das Gerichtsurteil kaum Auswirkungen auf ihre bisherige Einstellungspraxis. In der Landeskirche finde die EKD-"Loyalitätsrichtlinie" keine Anwendung, sagte Pressesprecher Volker Rahn in Darmstadt. Aktuell seien 92,3 Prozent Kirchenmitglieder bei der hessen-nassauischen Kirche beschäftigt.
Die Einstellungsvoraussetzungen der EKHN seien in einem eigenen Gesetz geregelt, sagte Rahn. Dieses Einstellungsgesetz gehe grundsätzlich davon aus, dass Bewerber um einen Arbeitsplatz Mitglied in einer christlichen Kirche sein müssten. Allerdings könne "aus konzeptionellen oder arbeitsmarktpolitischen Gründen von dieser Voraussetzung abgesehen werden", sagte Rahn. Wie in jedem Arbeitsverhältnis korrespondiere mit der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers die Treuepflicht der Mitarbeiter. Diese dürften mit ihrem Verhalten nicht grundsätzlich den grundlegenden Zielen und Inhalten der Kirche widersprechen.
Diakonie reagiert schon auf veränderte Gesellschaft
In Einrichtungen der evangelischen Diakonie sind "längst Mitarbeiterinnen mit Kopftuch oder ohne Konfession" beschäftigt, wie der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, am 25. April in seinem Blog schreibt. Dass Nichtchristen in Kindergärten in Stadtteilen mit vielen Migranten, in Pflegeheimen und Krankenhäusern arbeiten, habe "etwas mit unserem Selbstverständnis in einer sich verändernden Gesellschaft, aber auch mit Professionalität und Pragmatismus zu tun", erklärt Lilie mit Blick auf das EuGH-Urteil.
Nach dem Luxemburger Urteil kann die Diakonie nicht mehr für jede Stelle Religionszugehörigkeit verlangen. Im Klagefall wird gefragt: Ist für den konkreten Arbeitsplatz Konfessionszugehörigkeit "wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt", wie es das EuGH verlangt? "Ich finde diese Frage berechtigt. Es ist auch gut, dass im Streitfall Gerichte hier schlichten können", schreibt Lilie. Der Diakoniechef ergänzt aber auch: "Es stellt sich mir die Frage, wie zunehmend säkular sozialisierte Richterinnen und Richter, die keine kirchliche oder diakonische 'Feldkompetenz' mehr haben, arbeitsrechtliche Richtlinien für Kirchen festlegen können werden? Woher gewinnen sie ihre Kriterien?"
Der Theologe weist zudem darauf hin, dass die evangelische Kirche "auf das Priestertum aller Gläubigen" setze. "Es ist möglich, so glauben wir, dass jede Reinigungskraft, jede Referentin oder Sachbearbeiterin eine Prophetin sein kann. Darum ist es uns nach wie vor wichtig, in allen Arbeitsbereichen und auf allen Hierarchieebenen Menschen zu beschäftigen, die glauben", erklärt er.
Diakonie: Keine unmittelbaren Auswirkungen
Für Oberkirchenrat Christoph Stolte, Vorstandsvorsitzender der Diakonie in Mitteldeutschland, hat die Einschränkung des Spielraums kirchlicher Arbeitgeber durch den Europäischen Gerichtshofs keine unmittelbaren Auswirkungen auf die bisherige Einstellungspraxis. In den diakonischen Einrichtungen seien nicht konfessionell gebundene Mitarbeitende seit langem Teil der Dienstgemeinschaft: "Ohne sie könnten wir unseren kirchlichen Auftrag im Einsatz für Menschen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, gar nicht erfüllen", sagte Stolte der in Weimar erscheinenden Mitteldeutschen Kirchenzeitung "Glaube + Heimat".
Die Diakonie Mitteldeutschland achte zwar darauf, dass viele Mitarbeitende getauft seien und ihren Dienst als Leben ihres christlichen Glaubens verstünden, so Stolte, "zugleich sind wir auch offen für Menschen, die das biblische Menschenbild mittragen und sich mit den Leitgedanken der Diakonie identifizieren."
Stolte begrüßte die Entscheidung des EuGH, da sie das in Deutschland grundgesetzlich geschützte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen anerkenne. Zugleich entstünden durch das Urteil stärkere Begründungspflichten bei der Ablehnung von nichtkirchlichen Bewerbern. Allerdings sei es für eine abschließende Bewertung noch zu früh. Es sei abzuwarten, wie das Bundesarbeitsgericht mit der Entscheidung des EuGH umgehe.
Kirchen
Kliniken
Gastbeitrag
"Christliches Profils seriös nach außen darstellen"

epd-bild/Joachim Albrecht/St.-Franziskus-Stiftung
Münster (epd). Wie andere kirchliche Träger haben die Einrichtungen der St. Franziskus Stiftung zahlreiche Maßnahmen ergriffen, Initiativen entwickelt und Projekte realisiert, um ihr christliches Profil umzusetzen. Wir sind der Meisung: Die Einlösung des christlichen Selbstanspruches ist ein stetiger Unternehmensentwicklungsprozess, für den es geeigneter Instrumente und Maßnahmen bedarf.
Dazu haben wir ein Managementinstrument namens "Christlichkeit im Krankenhaus" (CiK) entwickelt. Dieses Instrument hat zum Ziel, das christliche Profil in den Einrichtungen unserer Stiftung, die zu den größten konfessionellen Krankenhausträgern Deutschlands zählt, zu stärken und nachvollziehbar transparent zu machen.
Dazu wurden Standards festgelegt und mit entsprechenden Indikatoren hinterlegt. Mit Hilfe des CiK ist es nun für Krankenhäuser möglich, sich im Hinblick auf ihr christliches Profil selbst einzuschätzen, einem Reflexionsgespräch zu stellen und darauf aufbauend weitere Schritte zu planen.
Strukturen und Prozesse werden zusammengeführt
Wir halten das CiK für ein praxistaugliches Instrument, mit dessen Hilfe vorhandene Strukturen, Prozesse und Aktivitäten in einer Gesamtsystematik zusammengeführt werden. Es hilft Trägern und Einrichtungen, die Entwicklung ihres christlichen Profils gezielt und nachhaltig voranzubringen. Die Christlichkeit einer Einrichtung wird dadurch zu einem Bereich, der systematisch im Blick- und Verantwortungsfeld der Unternehmensleitung liegt. Zudem fördert das CiK den Austausch und ermöglicht Lernerfahrungen für alle Beteiligten.
Freilich: Das CiK ist nur ein Hilfsmittel. Die Maßnahmen sollen in erster Linie den Patienten und Mitarbeitern zugutekommen. Die Patienten sollen sicher davon ausgehen können, dass in einer christlichen Einrichtung Mindeststandards erfüllt werden oder zumindest daran ernsthaft und gewissenhaft gearbeitet wird.
In gleicher Weise soll das CiK dazu dienen, die Arbeit im Bereich des christlichen Profils seriös nach außen darzustellen. Es geht nicht um ein plakatives Marketing, sondern um eine verantwortete Berichterstattung. Was in der Öffentlichkeit dargestellt wird, muss durch interne Maßnahmen und Ergebnisse gedeckt sein.
Interdisziplinäres Team leistete Entwicklungsarbeit
Das CiK wurde von einem interdisziplinär zusammengesetzten Team entwickelt. Alle bestehenden Instrumente wie beispielsweise proCum Cert sind im Rahmen der Entwicklung gesichtet worden. Das CiK umfasst unterschiedliche Unternehmensbereiche. Es ist in fünf Themenbereiche gegliedert: Werte, Patienten und Bewohner, Mitarbeiter, Prozesse und Partner, Finanzen und Ressourcen.
Alle fünf Themenbereiche werden in weiteren Unterkapiteln entfaltet. Für den Bereich Werte sind das beispielsweise: Unternehmensgestaltung, Seelsorge, Spiritualität, Ethik, Schöpfung. Zudem folgt noch eine dritte Gliederungsebene. Mit dieser Untergliederung ist schließlich eine Konkretionsebene erreicht, die eine angemessene Abbildung in Indikatoren ermöglicht. Insgesamt besteht das CiK aus fünf Themenbereichen, 46 Themenfeldern und über 200 Indikatoren.
Wie funktioniert nun die Arbeit mit dem CiK konkret? Wer damit arbeitet, erstellt zunächst eine Selbstbewertung. Dazu werden die Indikatoren auf der Grundlage eines Ampelsystems beurteilt. Nach der Selbstbewertung sind die gesamten Indikatoren und Themenfelder mit Farben hinterlegt, die sich am bekannten Ampelprinzip orientieren.
Das Team der Selbstbewertung setzt sich mindestens zusammen aus dem Geschäftsführer/Kaufmännischen Direktor, dem Pflegedirektor/der Pflegedienstleitung, einem Mitarbeiter aus der Pflege, einem Mitglied der MAV, einem Qualitätsbeauftragten, einem Seelsorger und dem Vorsitzenden des Ethikkomitees. Der Zeitaufwand beträgt je nach Größe der Einrichtung drei bis fünf Stunden.
Reflexion und Selbstbewertung
Einige Woche nach der Selbsteinschätzung folgt ein sogenanntes Reflexionsgespräch, in dem die Selbstbewertung mit drei Personen aus dem CiK-Team besprochen wird. Hierfür ist ein halber Tag vorgesehen. Im Anschluss an das Reflexionsgespräch erstellt die Einrichtung einen verbindlichen Maßnahmenplan. Insgesamt haben wir darauf geachtet, dass das Verfahren mit einem überschaubaren Zeitaufwand zu bearbeiten ist.
Inzwischen ist die Pilotphase abgeschlossen und fünf unserer Krankenhäuser haben sich auf der Grundlage des CiK selbst bewertet. Bei drei Einrichtungen fanden bereits die Reflexionsgespräche statt. Das CiK ist auch auf die Bedürfnisse von Behinderten- und Senioreneinrichtungen angepasst worden. Eine unserer Behinderteneinrichtung hat das Verfahren ebenfalls komplett durchlaufen. Im nächsten Schritt werden alle Einrichtungen der Franziskus Stiftung mit dem CiK arbeiten.
Das CiK ist zwar von der Franziskus Stiftung entwickelt worden, kann aber auch in weiteren kirchlichen Krankenhäusern des Bistums Münsters zum Einsatz kommen. Dazu gibt es eine Kooperation mit dem Bischöflichen Generalvikariat des Bistums Münster und dem Diözesan-Caritasverband des Bistums.
Dazu ist eine Steuerungsgruppe eingesetzt worden, die die Anwendung des CiK koordiniert. In einer Netzwerkkonferenz treffen sich künftig Vertreter aller teilnehmenden Einrichtungen, um Erfahrungen auszutauschen und das CiK weiterzuentwickeln. Schließlich sind regelmäßige CiK-Foren geplant, auf denen Erfahrungen und Informationen auf der Arbeitsebene ausgetauscht werden können.
Zusammenarbeit folgt genauen Spielregeln
Auf diesem Weg soll und wird sich das CiK weiterentwickeln. Für die gemeinsame Zusammenarbeit sind Spielregeln aufgestellt, in denen es darum geht, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und Wissen zu teilen. Eine Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Träger und Leitungen die Teilnahme ernsthaft unterstützen und entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen.
Für die Teilnahme am CiK gibt es kein Zertifikat. Es geht nicht darum, von außen zu beurteilen, ob eine Einrichtung ein christliches Profil hat oder nicht. Dieses Urteil wäre vermutlich auch vermessen. Vielmehr geht es darum, dass sich eine Einrichtung ehrlich und selbstkritisch den Kriterien stellt und sich auf diesen Prozess einlässt.
Wer sich daher mit Hilfe des CiK auf den Weg macht, braucht den Mut zu einer offenen und ehrlichen Selbsteinschätzung. Wer sich selbst täuschen möchte, kann das tun. Aber warum sollte er sich diese Mühe machen, wenn er dafür kein Zertifikat bekommt? Das CiK versteht sich also nicht als ein Sanktionsinstrument, sondern bewusst als ein Instrument zur Motivation.
Armut
Sozialverband setzt auf deutliche Änderungen bei Hartz IV

epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). Außerdem müssten die Hartz-IV-Sätze "auf ein menschenwürdiges Niveau" angehoben werden, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Der VdK und die Grünen begrüßten den Vorstoß.
Schneider sprach sich dafür aus, dass in einem ersten Schritt der Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen von aktuell 416 Euro auf 571 Euro erhöht werden solle. Die Regelleistungen schützten nicht vor Armut. Ferner forderte der Verband ein Mindestarbeitslosengeld über dem Hartz-IV-Niveau sowie eine existenzsichernde Kindergrundsicherung.
"Hartz IV ist gefloppt"
Hartz IV sei gefloppt, stellte der Paritätische fest. 42 Prozent der rund 900.000 Langzeitarbeitslosen sei schon länger als vier Jahre im Hartz-IV-Bezug, mehr als eine Million Menschen bereits seit Einführung des Systems auf Leistungen angewiesen. Die "faktische Vermittlungsquote" liege bei arbeitslosen Hartz-IV-Beziehern bei lediglich fünf Prozent.
Der sozialpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Sven Lehmann, warf der Bundesregierung vor, sie habe die Regelsätze für die knapp sechs Millionen Leistungsbezieher, darunter zwei Millionen Kinder, künstlich kleingerechnet. Außerderm forderte er, die "Hartz-IV-Logik des Misstrauens und der Kontrolle" zu beenden.
Der Sozialverband VdK beklagte, dass die verschärften Sanktionen bei jungen Erwachsenen dazu führten, dass diese den Kontakt zum Jobcenter abbrechen. Präsidentin Ulrike Mascher forderte, dass mehr für die Teilhabe am Arbeitsleben, gerade für die Langzeitarbeitslosen, getan werden müsse. "Die Erhöhung der Hartz IV-Regelsätze ist ein wirksames Mittel im Kampf gegen Armut." Viele Kosten seien zu niedrig angesetzt und decken nicht den tatsächlichen Bedarf der betroffenen Menschen. Die Regelsätze müssten um mindestens 20 Prozent angehoben werden, damit sie das Existenzminimum abdecktenen, betonte Mascher.
Rückkehr zu Einmalleistungen gefordert
Auch größere notwendige Anschaffungen, wie zum Beispiel Waschmaschinen oder Brillen müssten wieder als Einmalleistungen gewährt werden. Zudem sollten die Stromkosten in tatsächlicher Höhe übernommen und die Mietobergrenzen an den aktuellen Wohnungsmarkt angepasst werden.
Das Arbeits- und Sozialministerium ist für die Festlegung der Hartz-IV-Regelsätze zuständig. Sie müssen das Existenzminimum abdecken und werden anhand der Konsumausgaben von Haushalten am unteren Ende der Einkommensskala berechnet. Außer dem Regelsatz werden von den Jobcentern die Mieten für "angemessene Wohnungen" und die Heizkosten übernommen. Die Höhe der Regelsätze wird jährlich überprüft.
Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach für Änderungen bei Hartz IV ausgesprochen. So will der Minister unter anderem die Sanktionen überprüfen und das Schulstarterpaket für bedürftige Kinder verbessern. Am Berechnungsmechanismus für die Regelsätze soll aber zunächst nichts geändert werden.
Kirchen
Caritas-Verbände gründen erste Genossenschaft
Paderborn, Dortmund (epd). Caritasverbände im Erzbistum Paderborn haben die bundesweit erste Genossenschaft der Caritas gegründet. Ziel sei es, administratives und technisches Wissen für die Caritas-Träger gebündelt zu organisieren, erklärte der Vorstandsvorsitzende der neuen Genossenschaft, Patrick Wilk, am 24. April in Paderborn. Die Genossenschaft soll mit den Bereichen Einkauf, EDV und Datenschutz am 1. Mai starten.
Die "Caritas-Dienstleistungs- und Einkaufsgenossenschaft im Erzbistum Paderborn" (cdg) wurde im Katholischen Centrum in Dortmund von insgesamt 16 Verbänden und Trägern der Caritas aus dem Erzbistum Paderborn gegründet. Das Grundkapital beträgt den Angaben zufolge 500.000 Euro.
Der Vorteil für die jeweils selbstständigen Verbände und Einrichtungsträger liege in den Synergie-Effekten, erklärte Wilk, der auch Vorstand des Caritasverbandes Paderborn ist. Damit würden die Mitglieder und Kunden teure Ausbildungen und Abhängigkeiten von Spezialisten oder die Beauftragung externer Dienstleister sparen.
Zu den Gründungsmitgliedern der Genossenschaft gehören neben dem Diözesan-Caritasverband Paderborn zwölf örtliche Caritasverbände, zwei Caritas-Fachverbände sowie eine Caritas-Tochtergesellschaft. Die Paderborner Bank für Kirche und Caritas schloss sich der Genossenschaft als investierendes Mitglied an.
Kirchen
Pflege
Ausbildung
Diakonie fordert Hilfe für Pflegeschulen bei Ausbildungsreform
Düsseldorf (epd). Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) hat wegen der geplanten Reform der Pflegeausbildung finanzielle Unterstützung für Pflegeschulen von Bund und Ländern gefordert. "Wir wünschen uns eine Art 'Innovationsfinanzierung', denn der große Umstellungsprozess für die Schulen ist nicht zum Nulltarif zu haben", sagte die Diakonie-Pflegeexpertin Heidemarie Rotschopf am 24. April in Düsseldorf. Die Pflegeschulen stünden vor einer "Herkulesaufgabe", denn sie müssten innerhalb von nur anderthalb Jahren einen völlig neuen Lehrplan mit 2.100 Stunden Theorie und 2.500 Stunden Praxis gestalten.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Ende März den Entwurf der neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die geplante einheitliche Ausbildung für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpfleger vorgelegt. Am 4. Mai können die Sozialverbände laut Diakonie im Bundestag dazu Stellung nehmen. Die Verordnung soll Ende des Jahres in Kraft treten, anschließend haben die Länder ein Jahr Zeit, sie umzusetzen. Die neue Pflegeausbildung soll 2020 starten.
Die Diakonie RWL begrüßte, dass die generalistische Pflegeausbildung umgesetzt wird. Die Kombination der Ausbildungen von Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegern sei aber für die Pflegeschulen eine echte Herausforderung, erläuterte Pflegeexpertin Rotschopf. So solle künftig nicht mehr nach Fächern unterrichtet werden, sondern nach Kompetenzbereichen.
Nationalsozialismus
Frauen
Die vergessenen Nazi-Opfer von Aichach

epd-bild/Muenchner Pressebuero
München (epd). Zeitweilig waren in der für 500 Insassen gebauten Haftanstalt bis zu 2.000 Frauen untergebracht. Deren Leid solle nicht vergessen werden, betont das Frauenforum Aichach-Friedberg. Es wirbt für einen würdigen Gedenkort für die NS-Opfer von Aichach - und hat den Historiker Franz Josef Merkl mit Nachforschungen beauftragt.
Unter den Inhaftierten waren auch bekannte Frauen wie die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. In Aichach wurden auch sogenannte "asoziale" Frauen zwangssterilisiert und mehr als 360 Frauen aus der "Sicherheitsverwahrung" nach Auschwitz in den Tod geschickt.
Lange Zeit ohne jede Beachtung
"Viel zu lange wurde bei all den Bemühungen zur Aufarbeitung der Nazizeit den Frauen in der Strafanstalt keine Beachtung geschenkt", sagt Forumssprecherin Jacoba Zapf. In der Tat weist nichts in der schwäbischen Kreisstadt Aichach mit ihren rund 21.000 Einwohnern auf die Verbrechen hin, die während der Nazizeit im Frauengefängnis geschahen, von Aufarbeitung oder gar Entschädigung und Anerkennung als Opfer des NS-Regimes ganz zu schweigen.
Zwar existiert in dem 1909 in Betrieb genommen Gefängnis mit heute 433 Haftplätzen für Frauen ein kleines historisches Museum, das aber nicht explizit die NS-Historie beleuchtet. Gezeigt werden unter anderem ein gynäkologischer Behandlungsstuhl, Gefängniskleidung oder eine Kamera, die Fotos für die Verbrecherkartei lieferte.
In einer Ecke ist zu lesen, dass eine Gefangene, Anna G., am 19. Februar 1940 43 Nägel, 10 Näh- und zwei Stecknadeln verschluckte - Nägel und Nadeln sind zu besichtigen. Warum Anna G. sich diese Tortur angetan hat, bleibt ebenso unklar wie das gesamte Konzept der Ausstellung.
Verharmlosung des Massenmordes
Ohne weitere Erklärung bleiben auch diese acht Zeilen aus der NS-Zeit: "Im 'Gefangenenbuch Sicherungsverwahrung' verzeichnete Überstellungen beginnen mit 8.12.1942 'an Polizei überstellt', danach ab Januar 1943 'mit Auschwitz überstellt'." Für die meisten Häftlinge bedeutete die Überstellung in ein KZ das sichere Todesurteil. Offiziell hieß das "Strafunterbrechung" – eine verharmlosende Bezeichnung für den erfolgten Massenmord.
Den verschiedenen Frauenschicksalen ist nun im Auftrag des Frauenforums der Historiker Franz Josef Merkl auf der Spur. Finanziert wird die Recherche von mehreren lokalen Sponsoren. Merkl zeigt etwa auf, wie sich unter den Nazis die Zahl der eingesperrten Frauen mehr als verdreifachte. Zählte man 1933 noch 691 Gefangene, stieg diese Zahl bis 1945 auf 2.000, hinzu kamen an die 1.000 Frauen in den Außenlagern.
Zu ihnen zählten viele Frauen, die wegen Wehrkraftzersetzung (also der Kritik am Krieg) oder sogenannten Rundfunkverbrechen wie dem Abhören von ausländischen Radiosendern verurteilt waren. Auch sogenannte "asoziale" Frauen kamen hier hinter Gitter, wobei die Nazis unter diesem Begriff alles fassten, was vom angeblich "gesunden Menschenverstand" abwich. Unter diese "Ballastexistenzen" fielen Alkoholkranke ebenso wie "Arbeitsscheue", Landstreicher, Langzeitarbeitslose, Bettler oder Prostituierte.
110 Fälle der Zwangssterilisierung nachgewiesen
Für die "Reinhaltung der Rasse" wurden in Aichach auch Frauen zwangssterilisiert. Historiker Merkl konnte anhand von Rechnungen mindestens 110 dieser Zwangsmaßnahmen nachweisen.
Das Frauenforum möchte dauerhaft an die gepeinigten Frauen erinnern, auch weil sie als "Asoziale" bis heute nicht als Opfer des NS-Regimes anerkannt sind. Wie das genau aussehen wird, als Tafel oder Stele etwa, in der Stadt Aichach oder nahe dem Gefängnis, ist derzeit noch unklar. Es gehe zunächst um eine öffentliche Diskussion, die angestoßen wird.
Bewegung gibt es auch in der Frage der Anerkennung der Opfer. Eine Initiative um den Frankfurter Soziologieprofessor Frank Nonnenmacher hat eine Petition an den Bundestag auf den Weg gebracht, um zwei der letzten Opfer-Gruppen zu ihrem Recht zu verhelfen. Der Initiator dringt darauf, die "Berufsverbrecher" und die "Asozialen" in einer gemeinsamen Entschließung "die Anerkennung der ehemaligen KZ-Häftlinge mit den schwarzen und grünen Winkeln als Opfer des Nationalsozialismus auszusprechen". 15.000 Unterschriften werden gebraucht: Derzeit sind es knapp 11.000.
Nationalsozialismus
Neuer Gedenkort für Hamburger Euthanasieopfer
Hamburg (epd). Vor der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn, der heutigen Asklepios-Klinik Nord in Ochsenzoll, wird am 2. Mai eine neue Gedenkstätte für die Euthanasie-Opfer der NS-Zeit eingeweiht. Über 3.600 Patienten wurden von der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn in Tötungs- und Verwahranstalten verlegt, teilte die Ev. Stiftung Alsterdorf am 23. April mit. Über 2.400 davon fielen dem Euthanasie-Programm zum Opfer, weitere zwölf Kinder wurden bei medizinischen Versuchen ermordet.
Die neue Gedenkstätte wurde geschaffen, um der Opfer zu gedenken und über den zentralen Ort der NS-Euthanasie in Hamburg-Langenhorn zu informieren, hieß es. Gäste bei der Einweihungsfeier sind unter anderem Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und Bischöfin Kirsten Fehrs.
Gemeinsam wollen die Ev. Stiftung Alsterdorf und die Asklepios-Klinik Nord am 2. Mai der behinderten Menschen gedenken, die während der NS-Zeit ermordet wurden.
Wohnungsbau
Sozialverbände üben Kritik an geplanter Landesbauverordnung
Düsseldorf (epd). Die Sozialverbände in Nordrhein-Westfalen machen gemeinsam Front gegen die geplante neue Landesbauverordnung. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Modernisierung des Baurechts sei für die Barrierefreiheit ein Rückschritt und fördere die Diskriminierung behinderter Menschen, heißt es in einer am 23. April in Düsseldorf veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des Sozialverbands VdK, des Sozialverbands Deutschland (SoVD) in NRW und des Landesverbands "Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben" NRW.
Die Sozialverbände rügten vor allem eine weiterhin fehlende Kopplung barrierefreier Wohnungen an einen entsprechenden barrierefreien Zugang. Zwar sollen laut Gesetzentwurf alle neuen Wohnungsgebäude ab sieben Meter Höhe barrierefrei sein. Doch erst ab Bauten mit mindestens sechs statt bislang fünf Stockwerken soll es nun barrierefrei zugängliche Aufzüge geben. Das sei ebenso "absurd" wie das Manko, für die dringend nötige Schaffung von Wohnraum für Rollstuhlfahrer keine rechtlich verbindliche Mindestzahl mehr vorzugeben, kritisierten die Verbände. Für öffentliche Gebäude sei Barrierefreiheit zudem unverbindlich nur "im erforderlichen Umfang" vorgesehen.
Der Gesetzentwurf sei nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung bedauerlich, warnten die Sozialverbände. "Baupolitik ist und bleibt ein Stück Sozialpolitik", betonte der Vorsitzende des VdK NRW, Horst Vöge. Doch offenbar habe das "starrsinnige Beharren auf wirtschaftlichen Interessen" Vorrang. Dabei sind nach Berechnungen der Sozialverbände die Baukosten für barrierefreie Wohnungen nur unwesentlich um bis zu ein Prozent höher.
sozial-
Bundesgerichtshof
Demenzkranke können für sich selbst Betreuer vorschlagen

epd-bild/Joern Neumann
Karlsruhe (epd). Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 18. April veröffentlichten Beschluss. In zwei weiteren Entscheidungen klärten die Karlsruher Richter außerdem, wie sich eine "erheblich beeinträchtigte" freie Willensbildung eines Betroffenen auf die Betreuerbestellung auswirkt und unter welchen Voraussetzungen ein Betreuer bestellt werden kann, wenn der Aufgabenkreis der Betreuung sich erweitert.
Im ersten Fall ging es um eine verheiratete 74-jährige demenzkranke Frau aus dem Raum Augsburg. Ihre Nichte und ihre Schwägerin hatten für sie beim Betreuungsgericht eine Betreuung angeregt. Seit zwölf Jahren wurde die Patientin von ihrem Lebensgefährten und jetzigem Ehemann unterstützt. Die Frau legte dagegen Beschwerde ein und verlangte, dass ihr Ehemann die Betreuung übernehmen soll.
Doch dagegen stünden "gewichtige Umstände", befand das Landgericht. Zwar habe sich der Ehemann um sie zuverlässig gekümmert und sie gepflegt. Dennoch komme er als Betreuer nicht in Betracht. Denn: Es sei mit Konflikten zwischen ihm und der restlichen Verwandtschaft zu rechnen, was wiederum die Frau unnötig belasten könne. Auch könne der Mann ihren Gesundheitszustand nicht richtig einschätzen, befand das Gericht.
"Willensbekundung reicht aus"
Zwar habe die Frau einen Betreuerwunsch geäußert, sie sei aber wegen ihrer fehlenden Geschäftsunfähigkeit gar nicht zu einer eigenen Willensentscheidung fähig.
Doch der BGH sah das anders: Für einen Betreuervorschlag sei weder Geschäftsfähigkeit noch "natürliche Einsichtsfähigkeit" erforderlich, entschied der BGH. Es reiche aus, dass die Betroffene ihren Willen kundtut.
Der Wille der Betroffenen könne nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn die Bestellung der vorgeschlagenen Person ihrem Wohl zuwiderläuft. Hierfür müsse jedoch eine konkrete Gefahr bestehen. Nach dem Gesetz müssten bei der Betreuerbestellung verwandtschaftliche Beziehungen berücksichtigt werden. Das gelte erst recht, wenn die Betroffene ihren Ehemann als Betreuer vorschlägt, entschied der BGH.
Schließlich habe das Landgericht den Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt, rügten die Karlsruher Richter. Es habe noch nicht einmal den Ehemann persönlich angehört. Das muss das Gericht nun nachholen und den Betreuer dann neu bestimmen.
Willensäußerung muss möglich sein
Im zweiten Fall stellte der BGH klar, dass auch eine festgestellte "erheblich beeinträchtigte Willensbildung" nicht ausreicht, um den Willen einer Betroffenen übergehen zu können. So dürfe ein Betreuer nicht gegen den Willen der Betroffenen, hier eine psychisch kranke Frau, bestellt werden, wenn gar nicht klar ist, ob sie nicht doch teilweise einen freien Willen äußern könne. Eine "erheblich beeinträchtigte Willensbildung" reiche nicht aus, um einen Betreuer über den Kopf der Betroffenen hinweg zu bestellen, entschied der XII. Zivilsenat des BGH.
Sollen die Aufgabenkreise einer bereits bestehenden Betreuung erweitert werden, muss demnach geprüft werden, ob der bisherige Betreuer dafür infrage kommt oder nicht doch ein Betreuerwechsel angebracht wäre, entschied der BGH im dritten Verfahren. Äußert die betreute Person den Wunsch, dass die neuen Aufgaben eine andere Person übernehmen soll, muss das zuständige Gericht in einem solchen Fall "unter Beachtung des Betreuervorschlags gegebenenfalls eine Mitbetreuung einrichten". Alternativ könne die Erweiterung des Aufgabenkreises Anlass für eine Überprüfung hinsichtlich der bereits bestehenden Betreuung sein, hieß es.
Az.: XII ZB 589/17 (Betreuervorschlag)
Az.: XII ZB 540/17 (freier Wille)
Az.: XII ZB 547/17 ((Aufgabenkreis)
Bundessozialgericht
Kassen müssen Fettabsaugen beim Reiterhosensyndrom nicht zahlen
Kassel (epd). Krankenkassen müssen bei einer schmerzhaften Fettgewebsstörung an Hüften und Beinen grundsätzlich nicht den stationären Klinikaufenthalt für eine Fettabsaugung bezahlen. Diese Behandlung des sogenannten Lipödems in einer Klinik entspreche nach derzeitigem Stand der Medizin nicht dem Qualitätsgebot, dass die Kassen gewährleisten müssen, urteilte das Bundessozialgericht am 24. April in Kassel.
Bei einem Lipödem, im Volksmund auch Reiterhosensyndrom genannt, handelt es sich um eine schmerzhafte Fettverteilungsstörung. Insbesondere an Beinen und Hüften, aber auch an den Armen sammelt sich verstärkt Fett an. Von der häufig vorkommenden Erkrankung sind fast nur Frauen betroffen. Gängige Therapien wie Lymphdrainagen oder das Tragen von Kompressionsstrümpfen sind für viele Patienten unbefriedigend, so dass die Kostenübernahme für eine Fettabsaugung in der Klinik gewünscht wird.
In einem der jetzt vom Bundessozialgericht entschiedenen Fälle sah die Klägerin aus Weinheim in der Fettabsaugung den letzten Ausweg. Sie ließ bei drei in der Klinik vorgenommenen Behandlungen Fett an den Beinen entfernen. Bereits bei der ersten Behandlung wurden an jedem Bein jeweils 7,9 Liter Fett entfernt.
Die Kosten von insgesamt 11.363 Euro wollte ihre Krankenkasse, die Barmer, nicht bezahlen. Es gebe keine hinreichenden Studien, wonach die Behandlung auf Dauer erfolgreich ist. Das Bundessozialgericht lehnte die Kostenübernahme ebenfalls ab. Zwar habe der Gemeinsame Bundesausschuss, der über die von den Kassen zu gewährenden Leistungen entscheidet, die Prüfung der Fettabsaugungsbehandlung veranlasst. Doch nur weil die Fettabsaugung damit das Potenzial einer erfolgreichen Behandlungsalternative hat, müsse diese noch nicht von den Kassen bezahlt werden.
Die Kassen müssten sich an das Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebot halten, mahnten die Kasseler Richter. Nicht ausreichend erprobte Methoden dürften im Interesse des Patientenschutzes grundsätzlich nicht erbracht werden.
Az.: B 1 KR 10/17 R und B 1 KR 13/16 R
Landessozialgericht
Kneipenbesuch während der Kur ist keine Therapie
Stuttgart (epd). Wer während einer Kur eine Kneipe besucht und dabei stürzt, kann das nicht als Arbeitsunfall geltend machen. Ausflüge dieser Art unterliegen nicht dem Schutzbereich der gesetzlichen Unfallversicherung, wie das baden-württembergische Landessozialgericht in einem am 17. April in Stuttgart veröffentlichten Urteil entschied. Beim Besuch im Wirtshaus stehe nicht die Förderung des Kurerfolgs im Vordergrund, sondern private Geselligkeit und "Genusserleben", hieß es.
Eine 53-Jährige hatte geklagt, weil sie während einer Kur im Herbst 2016 in Todtmoos (Kreis Waldshut) bei einem abendlichen Besuch in einem Wirtshaus gestolpert war. Dabei fiel sie auf die linke Hand und brach sich den Ringfinger. Von der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft wollte sie das Unglück als Arbeitsunfall anerkannt haben. Begründung: Der Ausflug mit anderen Rehabilitanden sei Teil der Therapie gewesen.
Auf Rückfrage der Berufsgenossenschaft ließ die Klinik allerdings wissen, dass es keine Empfehlung der Ärzte zum Kneipenbesuch gegeben habe, sondern nur den allgemeinen Rat, gemeinsam mit anderen Patienten etwas zu unternehmen. Die Gruppe sei auch nicht von Therapeuten begleitet worden. Daraufhin lehnte die Berufsgenossenschaft die Anerkennung ab, wogegen die 53-Jährige klagte.
Das Landessozialgericht vertritt in seinem Urteil die Auffassung, dass die Versicherung nur greife, wenn "ein spezifischer sachlicher Zusammenhang gerade zu den durchgeführten Reha-Maßnahmen" bestehe. Der Spaziergang, die Einkehr in die Gaststätte und der anschließende Rückweg zur Klinik seien weder ärztlich angeordnet noch therapeutisch begleitet gewesen.
Az.: L 8 U 3286/17
Landessozialgericht
Hartz-IV-Unterbrechung kann Erbe retten
Hamburg (epd). Erbt ein Hartz-IV-Bezieher von einem verstorbenen Angehörigen einen Teil eines Grundstücks, muss nach einem Verkauf des Erbes der Erlös nicht immer das Arbeitslosengeld II mindern. Denn wurde der Hartz-IV-Leistungsbezug zwischen dem Erbfall und der Auszahlung des Erbes unterbrochen, gilt das Erbe bei erneuter Hartz-IV-Antragstellung als Vermögen, für das Vermögensfreibeträge geltend gemacht werden können, entschied das Landessozialgericht (LSG) Hamburg in einem am 9. April veröffentlichten Urteil.
Im konkreten Fall bekam eine alleinerziehende Hartz-IV-Bezieherin Recht. Die Frau war während ihres Elterngeldbezugs auf aufstockendes und nach der Elternzeit bis zum 25. Oktober 2009 ganz auf Arbeitslosengeld II angewiesen. Im Juni 2009 starb ihr Großvater, so dass die Frau als Angehörige im Rahmen einer Erbengemeinschat Miteigentümerin an einem Grundstück wurde.
Die Frau war dann zeitweise nicht mehr auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen, ab November 2010 erhielt sie erneut auftstockendes Arbeitslosengeld II. Als schließlich das geerbte Grundstück verkauft wurde, wurden ihr 5.330 Euro ausgezahlt.
Die Erbschaft sei als einmalige Einnahme und über sechs Monate verteilt als Einkommen mindernd anzurechnen, befand das Jobcenter. Zusammen mit ihrem Erwerbseinkommen, dem Kindesunterhalt und dem Kindergeld sei sie nicht mehr hilfebedürftig. Das Erbe sei nicht als Vermögen zu werten, da der Erbfall während des Hartz-IV-Bezugs aufgetreten war. Nur wenn jemand vor der ersten Hartz-IV-Antragstellung etwas erbt, könne ein Vermögen vorliegen, bei dem Freibebräge geltend gemacht werden könnten.
Das LSG urteilte jedoch, dass die Geldzahlung als Vermögen anzusehen sei und die Frau daher Anspruch auf Hartz IV habe. Ob das Erbe als Einkommen oder als Vermögen berücksichtigt werden muss, hänge daher davon ab, ob der Erbfall vor der ersten Antragstellung eingetreten ist. Als "erste Antragstellung" sei jedoch nicht der erste Hartz-IV-Antrag gemeint, der jemals gestellt wurde, so das LSG.
Dies sei vielmehr der Antrag, "der einen zusammenhängenden Bezugszeitraum erstmals auslöste". Wurde der Hartz-IV-Bezug dagegen unterbrochen, gelte der später erneute Antrag auf Leistungsbezug wieder als "Erstantrag". Der unterbrochene Leistungsbezug habe daher dazu geführt, dass die Auszahlung aus dem Erbe als Vermögen angesehen werden muss.
Az.: L 4 AS 194/17
Oberlandesgericht
Sturz im Linienbus: Gehbehinderte Frau scheitert mit Klage
Hamm, Bochum (epd). Der Fahrer eines Linienbusses ist nach einem Gerichtsurteil nicht automatisch für den Sturz eines schwerbehinderten Fahrgastes haftbar zu machen. Das Oberlandesgericht Hamm entschied in zwei am 20. April bekanntgegeben Beschlüssen, die Klage einer gehbehinderten Frau abzulehnen. Das OLG bestätigte damit ein erstinstanzliches Urteil des Landgerichts Bochum.
Die schwerbehinderte Frau hatte sich durch einem Sturz im Bus einen Oberschenkelbruch zugezogen, weil der Fahrer losgefahren war, bevor sie ihren Sitzplatz eingenommen hatte.
Wegen des Unfalls hatte die zum Zeitpunkt des Sturzes 60 Jahre alte Frau ein Schmerzensgeld von 11.500 Euro und die Übernahme der Kosten für eine Haushaltsführung in Höhe von rund 4.000 Euro gefordert. Ihre Klage richtete sich gegen das Verkehrsunternehmen und der Busfahrer. Die Frau ist wegen eines Hüftschadens zu 100 Prozent schwerbehindert, eine Gehhilfe benutzt sie nicht.
"Frau trägt Mitschuld"
Nach Ansicht des Oberlandesgerichts trägt die Frau eine Mitschuld an dem Unfall. Denn sie habe keinen freien Sitzplatz im Einstiegsbereich besetzt und sich beim Anfahren nicht genügend festgehalten. Auch habe sie den Busfahrer nicht darum gebeten, mit dem Anfahren abzuwarten, bis sie Platz genommen habe, befanden die Richter.
Dem Fahrer sei kein Verschulden vorzuwerfen, erklärte das Gericht. Von ihm sei nicht zu verlangen, dass er zugestiegene Fahrgäste besonders im Blick behalte. Eine solche Verpflichtung gebe es nur, wenn für den Fahrer eine schwerwiegende Behinderung des Fahrgastes erkennbar sei, die eine besondere Rücksichtnahme erfordere.
Ein solcher Ausnahmefall habe für den beklagten Busfahrer in dem konkreten Fall nicht vorgelegen, hieß es. Die Klägerin habe den Bus ohne erkennbare Probleme und ohne fremde Hilfe bestiegen. Auch habe sie keinen der nahe gelegenen, freien Sitzplätze eingenommen. Allein aus der Vorlage des Schwerbehindertenausweises habe der Busfahrer nicht schließen müssen, dass die Klägerin ohne eine besondere Rücksichtnahme gefährdet sei.
Az.: 11 U 57/17
sozial-
"Bobby 2018" geht an Eckart von Hirschhausen

epd-bild/Heike Lyding
Marburg (epd). "Eckart von Hirschhausen ist ein Glücksfall für unsere Gesellschaft", sagte die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt, am 26. April. Mit seinem Humor baue er erfolgreich Brücken für ein besseres Miteinander, für Teilhabe und Inklusion.
Der Preisträger stammt aus Frankfurt am Main. Er studierte an der Freien Universität Berlin, der Universität Heidelberg sowie am Royal Free Hospital in London Medizin. Von 1993 bis 1994 arbeitete er als Arzt im Praktikum in der Kinderneurologie der Freien Universität Berlin und promovierte 1994.
Schon während seiner Studienzeit sammelte von Hirschhausen erste Bühnenerfahrungen als Zauberkünstler und Varietémoderator. Nach 1994 absolvierte er ein Aufbaustudium zum Wissenschaftsjournalismus. Er wurde Kolumnist und schrieb auch mit großem Erfolg Bücher. Seit 1998 ist der vielseitige Mediziner auf deutschen Bildschirmen zu sehen.
Zur Auszeichnung sagte Eckart von Hirschhausen: "Als Arzt in der Kinderneurologie lernte ich viele Kinder und Familien mit seltenen, chronischen oder lebensbegrenzenden Erkrankungen kennen. Mit einzelnen habe ich bis heute Kontakt. Es gehört zu meinen Grundüberzeugungen, den Wert eines Menschen nicht an seiner Leistungsfähigkeit festzumachen."
Er teile diesen Preis mit seiner Schwester, die ihm seit ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer Lebensgemeinschaft mit behinderten Menschen vieles näher- und beigebracht habe. "Es gibt viele, die für ihr tägliches Tun den Preis mehr verdient hätten als ich. Diesen Menschen gilt mein ausgesprochener Dank, denn sie halten unsere Gesellschaft zusammen und menschlich." Die Preisverleihung findet am 15. November 2018 in Marburg im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten "60 Jahre Lebenshilfe" statt.
Weitere Personalien
Udo Sträter, Theologe und langjähriger Rektor der Martin-Luther-Universität in Halle, ist neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Franckeschen Stiftungen. Das Gremium als oberstes Organ der Stiftungen hat Sträter in das Ehrenamt gewählt, das er am 1. Juni übernimmt. Er gehört dem Kuratorium bereits seit 2010 an. Zudem wurde Anneheide von Biela als stellvertretende Direktorin der Franckeschen Stiftungen gewählt. Sie ist studierte Sozialpädagogin mit einem Masterabschluss für das Management von Nonprofitorganisationen und leitete seit September 2017 den sozialen und pädagogischen Bereich der Franckeschen Stiftungen.
Karin Böllert bleibt Vorstandsvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) in Berlin. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Münster. Mit ihrer Wiederwahl tritt Böllert schon ihre dritte Amtsperiode an. Die Delegierten der 100 Mitgliedsorganisationen bestätigten ebenfalls Martina Reinhardt, Abteilungsleiterin im Jugendministerium Thüringen in ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende. Reinhardt gehört dem Vorstand seit 2014 an. Neu in den Vorstand gewählt wurde Björn Bertram, Geschäftsführer des Landesjugendrings Niedersachsen. Er löst den aej-Generalsekretär Mike Corsa ab, dem die AGJ für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand und Geschäftsführenden Vorstand dankte.
Kai Jörg Sandner (38) ist erster Inhaber der neu geschaffenen Professur für Unternehmensethik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Mit der Professur erweitert die KU an ihrer Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt das Themengebiet Ethik, das bereits den Lehrstuhl für Wirtschaftsethik und Sozialpolitik und die Professur für Christliche Sozialethik und Gesellschaftspolitik umfasst. Sandner stammt aus Dachau und studierte Betriebswirtschaftslehre an der LMU München. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am dortigen Institut für Produktionswirtschaft und Controlling, wo er ebenfalls habilitierte.
Joachim Winter (51), Münchner Gesundheitsökonom, hat am 24. April im Hamburger Rathaus den mit 150.000 Euro dotierten Wirtschaftspreis der Joachim Hertz-Stiftung erhalten. Der Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität wird für sein breitgefächertes Forschungswerk ausgezeichnet, wie die Stiftung mitteilte. Zentrales Thema ist das Entscheidungsverhalten von Einzelpersonen. So untersucht er beispielsweise, welche Folgen frühkindlicher Hunger später auf Gesundheit und Ernährungsverhalten haben oder wie übergewichtige Menschen Gesundheitsrisiken beurteilen. Der Preis der Joachim Herz Stiftung ist nach eigenen Angaben die höchstdotierte Auszeichnung für wirtschaftswissenschaftliche Forschung in Deutschland.
Paula Weyand, Sozialarbeiterin, hat den Gerontologiepreis der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH erhalen. Sie wurde für ihre hervorragende Bachelorarbeit, die sie am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein eingereicht hatte, geehrt. Die Absolventin des Studiengangs Soziale Arbeit hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit der Dementia Care Mapping (DCM) Methode zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz in stationären Einrichtungen beschäftigt und dabei den Bogen von den theoretischen Grundlagen bis zur praktischen Anwendung im Pflegealltag geschlagen. "Das Thema ist von der Autorin nicht nur exzellent bearbeitet worden, es ist auch hochaktuell. Schon heute haben rund 70 Prozent der Bewohner unserer Einrichtungen eine Demenzerkrankung - und der Anteil steigt weiter an", sagte Bernhild Birkenbeil, Geschäftsleiterin der von der Sozial-Holding betriebenen städtischen Altenheime.
Johannes Donhauser hat am 26. April in Osnabrück die Johann-Peter-Frank-Medaille des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes erhalten. Donhauser ist Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen und stellvertretender Amtsleiter des Gesundheitsamtes Neuburg-Schrobenhausen in Bayern. Der ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende, Thomas Menn, bezeichnete den Preisträger als "nahezu einzigen Protagonisten für die Aufarbeitung der Tätigkeiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945". Donhauser setzt sich seit mehr als 20 Jahren dafür ein, die Rolle des öffentlichen Gesundheitsdienstes in der NS-Zeit ein.
sozial-
Die wichtigsten Fachveranstaltungen bis Juni
Mai
3.5. Berlin:
Seminar "ABC des Umsatzsteuer- und Gemeinnützigkeitsrechts"
der Unternehmensbeartung Solidaris
Tel.: 030/723823
http://u.epd.de/ywm
4.-6.5. Berlin:
Fachtagung "Es gibt mehr als (k)eine Lösung! Impulse und Anregungen für Lebensmodelle mit Kindern mit Behinderung"
des Bundesverbands für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen
Tel.: 0211/6400410
http://u.epd.de/ziq
7.-9.5. Magdeburg:
Seminar "Arbeitszeitmodelle und Dienstplangestaltung - lebensphasenorientiert und geschlechtergerecht"
der Fortbildungsakademie der Caritas
Tel.: 0761/200-1700
http://u.epd.de/zed
7.-9.5. Berlin:
Seminar "Betreuung und Unterstützung bei Menschen mit Demenz und Behinderungen"
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
http://u.epd.de/ywo
7.-9.5. Freiburg:
Seminar "Wenn das Miteinander zur Herausforderung wird. Führungskräfte als Vermittler bei Konflikt und Mobbing"
der Fortbildungsakademie der Caritas
Tel.: 0761/200-1700
http://u.epd.de/z8h
7.-9.5. Loccum:
Tagung "Übergriffig. Gewalt gegen Pflegekräfte"
der Ev. Akademie Loccum
Tel.: 05766/81115
http://u.epd.de/zil
8.-9.5. Frankfurt a.M.:
Seminar "Datenschutz in der Jugendhilfe - Was ändert die Datenschutz-Grundverordnung?"
der AWO Bundesakademie
Tel.: 030/263090
http://u.epd.de/z8l
15.5. Köln:
Seminar "Chancen- und Risikomanagement in Einrichtungen der Sozialwirtschaft - vom Umgang mit rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken"
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/97356-159
http://u.epd.de/ywi
15.5. Köln:
Seminar "Richtige Lizenzierung von Software im Gesundheitswesen"
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-221
http://u.epd.de/ywn
15.-16.5.: Berlin:
Seminar "Gewalt...? Prävention!"
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837488
http://u.epd.de/ze9
15.-17.5. Stuttgart:
Tagung "81. Deutscher Fürsorgetag - Zusammenhalt stärken, Vielfalt gestalten"
des Deutschen Vereins
Tel.: 030/62980-620
http://u.epd.de/ywk
16.5. Berlin:
Seminar "Fördermittelgewinnung bei Stiftungen"
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/97356-159
http://u.epd.de/ywjl
17.5. Köln:
Seminar "ABC des Umsatzsteuer- und Gemeinnützigkeitsrechts"
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-221
http://u.epd.de/z8j
17.-19.5. Paderborn:
Seminar "Datenschutz-Aktuell - Urteile und aktuelle Problemstellungen"
der Fortbildungsakademie der Caritas
Tel.: 0761/200-1700
http://u.epd.de/z8i
18.5. Köln:
Tagung "Roll back in der Geschlechterfrage. Gibt es einen Trend zurück zur traditionellen Rollenverteilung?"
des Sozialdienstes katholischer Frauen
Tel.: 0231/5570260
http://u.epd.de/ze8
23.-24.5. Fulda:
Tagung "Digital 2010: Wer hat uns im Griff? Freiheit und Selbstbestimmung vs. Algorithmen und künstliche Intelligenz"
des Bonifatiushauses Fulda
Tel.: 0661/8398144
http://u.epd.de/zii
Juni
4.-6.6. Berlin:
Seminar "Bundesteilhabegesetz (BTHG) - Herausforderung für die Eingliederungshilfe und Psychiatrie"
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837488
http://u.epd.de/zea
5.6. Köln:
Seminar "Good Corporate Governance in Caritas und Diakonie"
der Solidaris Unternehmensgruppe
Tel.: 02203/8997221
http://u.epd.de/zin
11.-12.6. Mülheima.d. Ruhr:
Seminar "MAV - erstes Arbeiten mit der MAVO"
der Katholischen Akademie Die Wolfsburg
Tel.: 0208/999190
http://u.epd.de/zee
11.-12.6. Berlin:
Seminar "Führung heute - ein Check-up für Führungskräfte"
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/97356159
http://u.epd.de/zio
11.-14.6. Freiburg:
Fortbildung "Konfliktmanagement als Führungsaufgabe"
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/2001700
http://u.epd.de/zeb
28.6. Köln:
Seminar "Social Media Marketing"
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/97356159
http://u.epd.de/zip

